Dossier
17 SDGs: Ziele für nachhaltige Entwicklung
Agenda 2030: Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen

Seit 2016 gilt die Agenda 2030, in der sich die Weltgemeinschaft 17 Ziele für eine sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Entwicklung gesetzt hat. Bis 2030 sollen die sogenannten Sustainable Development Goals, kurz: SDGs, erreicht sein. Zur Halbzeit findet nun am 18. und 19. September 2023 bei den Vereinten Nationen in New York der nächste SDG-Gipfel statt, bei dem die Fortschritte bei der Zielerreichung diskutiert werden. Was sind die Ziele? Wie weit ist die internationale Staatengemeinschaft in der Umsetzung? Und wo steht Deutschland? Unser Dossier bietet einen Überblick.
Was ist die Agenda 2030?
Die Agenda 2030 ist die Nachfolgeagenda der Agenda 21 und seit 1. Januar 2016 bis 2030 in Kraft. Die Agenda 2030 haben alle 193 UN-Mitgliedstaaten verabschiedet, sie ist rechtlich jedoch nicht bindend. In ihr werden die Ziele der Agenda 21 erweitert und konkretisiert.
Kernstück der Agenda 2030 sind die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten „Sustainable Development Goals“, kurz SDGs. Die SDGs wurden in Anlehnung an die Milleniumsentwicklungsziele (MDGs) der UN entwickelt. Neu ist jedoch, dass die SDGs an alle Länder addressiert sind, während die MDGs vor allem für Entwicklungsländer galten. Die Agenda 2030 beinhaltet fünf Kernbotschaften (5P), die den 17 SDGs vorangestellt sind:
- People: Die Würde des Menschen im Mittelpunkt in einer Welt ohne Hunger und Armut
- Planet: Den Planeten schützen durch die Begrenzung des Klimawandels und die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Prosperity: Wohlstand für alle fördern, indem Globalisierung gerecht gestaltet wird
- Peace: Frieden fördern durch die Einhaltung der Menschenrechte und eine gute Regierungsführung
- Partnership: Globale Partnerschaften aufbauen, um gemeinsam voranzukommen
Außerdem folgt die Agenda 2030 dem grundlegenden Prinzip „Niemanden zurücklassen“, dass also alle Menschen auf dem Weg hin zu nachhaltiger Entwicklung mitgenommen werden müssen.
Mehr erfahren?
Möchten Sie mehr darüber erfahren, seit wann Nachhaltigkeit als politisches Ziel diskutiert wird und was sich hinter Stichworten wie Brundtland-Kommission oder Agenda 21 verbirgt? Interessieren Sie sich dafür, welche Dimensionen von Nachhaltigkeit es gibt? Und möchten Sie gern wissen, was auf internationaler, nationaler, Landes- und kommunaler Ebene in puncto Nachhaltigkeit passiert? Dann empfehlen wir Ihnen unser Dossier „Nachhaltigkeit“.
Wie werden die Fortschritte bei der Erreichung der SDGs gemessen?
SDG-Monitoring
Internationale Ebene
Mit dem SDG-Monitoring wird der Umsetzungsstand der SDGs ermittelt. Auf internationaler Ebene haben sich die Vereinten Nationen auf 231 internationale SDG-Indikatoren geeinigt, um die Fortschritte zu messen. Jedem Staat bleibt es jedoch selbst überlassen, wie er das Monitoring genau ausgestaltet.
Einmal jährlich kommen die Staaten zum High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF, dt.: Hochrangiges Politisches Forum für Nachhaltige Entwicklung) in New York zusammen, um sich gegenseitig über den Umsetzungsstand zu informieren. Der nächste SDG-Gipfel findet zur Halbzeit der Agenda 2030 im September 2023 statt. Dort können die Mitgliedsstaaten ihren Freiwilligen Nationalen Staatenbericht vorstellen.
zum internationalen SDG-Report 2022 (auf Deutsch)
zum Freiwilligen Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021
Einen schnellen Überblick über die Fortschritte der SDG-Indikatoren erhalten Sie im SDG-Progress Chart 2022.
Europa und Deutschland
Auf europäischer Ebene gibt es seit 2017 ein EU-SDG-Indikatorenset mit rund 100 Indikatoren, um die Fortschritte der EU-Mitgliedstaaten zu messen. Eurostat veröffentlichte den letzten Monitoring-Bericht im Mai 2022.
In Deutschland wird die Umsetzung der SDGs von der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie begleitet, die zuletzt 2021 aktualisiert wurde. Der Umsetzungsstand der SDGs wird anhand 75 nationaler Indikatoren gemessen. Alle zwei Jahre legt das Statistische Bundesamt einen Indikatorenbericht vor, zuletzt im März 2021. Am Ende dieses Berichts findet sich eine Statusübersicht als kompakte Zusammenfassung der Fortschritte.
Auch für Baden-Württemberg und die kommunale Ebene gibt es entsprechende Nachhaltigkeitsstrategien und Messinstrumente.
Zivilgesellschaftliches Monitoring
Zivilgesellschaftliche Organisationen üben seit Jahren Kritik am offiziellen SDG-Monitoring. Indikatoren blieben schwach, manche würden gänzlich außen vorgelassen, die Wirksamkeit von Maßnahmen sei unklar, ebenso wer die Verantwortung bei Nichterreichung von Zielen trage. Daher hat das Forum Umwelt und Entwicklung ein zivilgesellschaftliches SDG-Monitoring entwickelt, um das offizielle deutsche Monitoring zu ergänzen.
Was sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Sustainable Development Goals (SDGs)
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals (SDGs), lauten:
Klicken Sie auf eine der Kacheln, um mehr über das ausgewählte Sustainable Development Goal (SDG) zu erfahren.
Welche Zielkonflikte bestehen?
Zwischen allen 17 UN-Nachhaltigkeitszielen bestehen Abhängigkeiten, aber vielfach auch Zielkonflikte. Vor allem SDG 8 „Wirtschaftswachstum und Beschäftigung“ wird häufig in direktem Spannungsverhältnis zu den ökologischen Zielen wie Klimaschutz oder der Erhalt von Ökosystemen und Biodiversität gesehen. Ist Wirtschaftswachstum möglich, wenn man gleichzeitig die begrenzten Ressourcen des Planeten schonen möchte? Ist Wachstum und Wohlstand mit ökologischen Zielen vereinbar? Und wie definiert sich überhaupt Wohlstand? In diesem Zusammenhang wird unter anderem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als klassischem Wohlstandsmaß kritisiert, das auch in der Agenda 2030 oder der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie als Indikator angewendet wird. Zu den diskutierten Alternativen gehört zum Beispiel die Idee von der Messung des Bruttonationalglücks aus Bhutan oder der Nationale Wohlfahrtsindex, der 21 wohlfahrtsstiftende und wohlfahrtsmindernde Aktivitäten berücksichtigt. In beiden Fällen wird Wohlstand nicht ausschließlich monetär, sondern ganzheitlicher definiert (Quelle: Global Policy Forum, 5-Jahres-Zwischenbilanz zur Agenda 2030). Einen ausführlichen Beitrag zur Diskussion um nachhaltiges Wachstum finden Sie bei Hauff, Der Weg zu einem nachhaltigen Wachstum, in: Bürger & Staat 4-2022 – Nachhaltigkeit, S. 185-192.
Es gibt Stimmen, etwa unter Klima- und Umweltschützer:innen, die den ökologischen Nachhaltigkeitszielen einen Vorrang gegenüber den anderen Zielen einräumen möchten. Ihre Begründung: Ohne einen intakten Planeten als Grundlage allen Lebens können auch alle anderen Ziele nicht erreicht werden. Gegner:innen dieser Sichtweise betonen, dass die 17 Nachhaltigkeitsziele voneinander abhängig sind und einen inklusiven Charakter besitzen. Alle drei Dimensionen von Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales – stünden gleichberechtigt nebeneinander und würden sich gegenseitig bedingen (Quelle: Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung, S. 42).
Michael Böcher spricht in diesem Zusammenhang von Nachhaltigkeit als einem „normativen Konzept“, über dessen Umsetzung unterschiedliche Akteur:innen diskutieren und Lösungen aushandeln müssen. Der Politik komme hierbei eine besondere Funktion zu: Denn ihre Aufgabe sei es, „bei unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen diese auszutarieren und am Ende kollektiv verbindliche, allgemein akzeptierte Lösungen zu erzeugen.“ Daher sei Nachhaltigkeit auch „aufgrund ihres normativen Gehalts und
der damit einhergehenden unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten ein politisches Konzept, das zur Aushandlung und Umsetzung politischer Prozesse bedarf“ (Quelle: Böcher, in: Bürger & Staat 4-2022 – Nachhaltigkeit, S. 169).
Nachhaltigkeit als normatives und politisches Konzept zeigt sich auch bei weiteren Konfliktdimensionen, etwa die Abwägung zwischen den Bedürfnissen und Freiheitsrechten des Einzelnen und dem Gemeinwohl, zwischen der lokalen und der globalen Ebene oder der Frage, wie weit der Staat bei der Zielerreichung eingreifen und was dem Markt bzw. dem eigenverantwortlichen Handeln überlassen bleiben soll.
Trotz aller Zielkonflikte wird jedoch stets betont, wie groß die Synergieeffekte zwischen den einzelnen SDGs sein können, wenn etwa Treibhausgase reduziert werden und dies gleichzeitig zu weniger Luftverschmutzung und weniger Krankheiten führt. Mit Synergien und Zielkonflikten speziell von Klimazielen und den SDGs hat sich die Friedrich-Ebert-Stiftung in der Studie „Rundum nachhaltig“ befasst. In eine ähnliche Richtung geht das internationale Forschungsprojekt „SDG pathways“.
#1 Keine Armut

Ziel ist es, bis 2030 Armut in allen ihren Formen und überall zu beenden. Hierbei geht es zum einen darum, existenzielle Armut in den ärmsten Ländern des globalen Südens zu bekämpfen. Zum anderen soll sich die Situation von Menschen mit niedrigem Einkommen in Industrieländern wie Deutschland verbessern.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Der Anteil an Menschen, die in Armut nach der jeweiligen nationalen Definition leben, soll mindestens um die Hälfte sinken.
- Alle Menschen sollen durch soziale Sicherungssysteme abgesichert sein.
- Alle Menschen sollen die gleichen Rechte und Chancen beim Zugang zu wirtschaftlichen und natürlichen Ressourcen wie Grundeigentum, neue Technologien oder Finanzdienstleistungen haben.
- Die Widerstandsfähigkeit gegenüber klimabedingten Extremereignissen und anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Katastrophen soll gestärkt werden.
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
Aktuell leben zwischen 660 und 670 Millionen Menschen in extremer Armut, die meisten davon in Afrika südlich der Sahara. Die Corona-Pandemie hat die Fortschritte von vier Jahren Armutsbekämpfung zunichte gemacht.
Extreme Armut bedeutet, weniger als zwei Euro pro Tag (1,90 US-Dollar) zum Leben zur Verfügung zu haben. In den letzten drei Jahrzehnten konnte sich schon eine Milliarde Menschen aus extremer Armut befreien. Doch die Corona-Pandemie, die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die Klimakrise haben viele Fortschritte zunichtegemacht und lassen die Armut wieder ansteigen. Prognosen zufolge dürften 2022 etwa 75 Millionen mehr Menschen in extremer Armut leben als vor der Pandemie erwartet. Steigende Nahrungsmittelpreise und die weitreichenden Auswirkungen des Krieges in der Ukraine könnten diese Zahl bis auf 95 Millionen Menschen anwachsen lassen.
So stieg die Erwerbsarmut im Jahr 2020 erstmals wieder seit zwanzig Jahren. Während der Pandemie erhielten nur rund ein Prozent der arbeitenden Menschen in ärmeren Ländern Arbeitslosengeld, während es in Ländern mit hohem Einkommen über die Hälfte war. Einkommenseinbußen oder der komplette Wegfall der Erwerbsquelle aufgrund der Corona-Pandemie traf Menschen in armen Ländern also besonders hart (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?
Rund 13 Millionen Menschen waren 2021 in Deutschland armutsgefährdet. Das entspricht knapp 16 Prozent der Bevölkerung Deutschlands. Als armutsgefährdet gilt, wer über ein Einkommen unterhalb von 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt. Vor allem Frauen ab 65 Jahren, Alleinlebende und Alleinerziehende mit Kindern sind armutsgefährdet (Quelle: Statistisches Bundesamt).
In Deutschland wird SDG 1 anhand der materiellen Deprivation gemessen, die den Mangel an bestimmten Gebrauchsgütern und den unfreiwilligen Verzicht auf ausgewählten Konsum aus finanziellen Gründen beschreibt. Dazu gehört zum Beispiel der Verzicht auf ein Auto oder Schwierigkeiten, die Miete zu bezahlen. Wenn vier der insgesamt neun Kriterien erfüllt sind, geht man von erheblicher Deprivation aus.
Ziel der Bundesregierung ist es, den Anteil der von Armut betroffenen Personen deutlich unter dem Niveau der Europäischen Union zu halten. Dies ist erfüllt: Während in Deutschland nur 6,8 Prozent der Personen materiell depriviert sind, sind es in der EU 13,1 Prozent. Bei der erheblichen materiellen Deprivation liegt Deutschland bei 2,6 Prozent, die EU bei 5,5 Prozent. In der Tendenz ist ein leichter Rückgang der materiellen Deprivation in den vergangenen Jahren zu verzeichnen (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).
Doch das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ und die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums aus dem Jahr 2020 kommen zu dem Schluss, dass die existierenden Indikatoren nicht ausreichen und die Armutsgefährdung in Deutschland gestiegen sei. So fehle beispielsweise der Indikator „Armutsgefährdungsquote“: Als armutsgefährdet sieht „2030 Watch“ 18,5 Prozent der deutschen Bevölkerung an, Soll-Wert sollte jedoch 8,3 Prozent sein. Mehr zum Thema Armut, Reichtum und Ungleichheit in Deutschland findet man im jährlichen Armuts- und Reichtumsbericht.
#2 Kein Hunger

Ziel ist es, bis 2030 den Hunger und die Mangelernährung auf der Welt zu beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung zu erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Ganzjährlicher Zugang zu ausreichend Nahrungsmitteln für alle Menschen
- Ausgewogene und gesunde Ernährung
- Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion und höhere Einkommen für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern
- Mehr nachhaltige Nahrungsmittelproduktion
- Bewahrung der genetischen Vielfalt von Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haustieren
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
800 Millionen Menschen leiden an Hunger. Das ist jeder zehnte Mensch weltweit. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass die Welt nach der Corona-Pandemie und aufgrund der Folgen des Klimawandels am Rande einer globalen Nahrungsmittelkrise steht. Der Krieg in der Ukraine gefährdet die Ernährungssicherheit zusätzlich und könnte den Hunger in der Welt sprunghaft ansteigen lassen.
Seit 2014 steigt die Zahl der von Hunger und Ernährungsunsicherheit betroffenen Menschen wieder an. Aufgrund der Corona-Pandemie litten 2021 150 Millionen mehr Menschen Hunger als noch 2019. Zudem hatte fast ein Drittel der Menschheit (2,3 Milliarden Menschen) 2021 keinen regelmäßigen Zugang zu ausreichender Nahrung.
Eine weitere Bedrohung für die Ernährungssicherheit ist der Krieg in der Ukraine. Die Ukraine und Russland gelten als „Kornkammern der Welt“ mit ihren Getreide- und Maisexporten sowie ihren weltweiten Ausfuhren von Erzeugnissen aus Sonnenblumenkernen. Viele afrikanische Staaten und andere Länder des globalen Südens beziehen über die Hälfte ihres Weizens von dort. Aufgrund des Krieges kommt es zu Lieferengpässen und stark steigenden Nahrungsmittelpreisen, die sich viele Menschen nicht mehr leisten können.
Hunger, Mangel- und Fehlernährung trifft insbesondere Kinder schwer: 2020 waren weltweit 22 Prozent (149 Millionen) der Kinder unter 5 Jahren wachstumsgehemmt, das heißt zu klein für ihr Alter. 2015 waren es noch 24,4 Prozent gewesen. Zur Erreichung der Zielvorgabe, die Zahl der wachstumsgehemmten Kinder bis 2030 zu halbieren, muss sich die Rückgangsrate von derzeit jährlich 2,1 Prozent auf 3,9 Prozent verdoppeln. In reicheren Ländern leiden dagegen mittlerweile viele Kinder an Übergewicht aufgrund von ungesunder Ernährung und mangelnder Bewegung. Weltweit sind dies rund 39 Millionen Kinder (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?
In Deutschland muss niemand an Hunger leiden, weshalb in Deutschland eher Themen wie die Stickstoffbelastung in der Landwirtschaft oder der Anteil von ökologischem Landbau eine Rolle spielen. Doch auch hierzulande machen vielen Menschen die steigenden Lebensmittelpreise zu schaffen. Der Andrang bei den rund 960 Tafeln in Deutschland wird immer größer, im Dezember 2022 waren es rund zwei Millionen Menschen (Quelle: ZDF online).
In Deutschland wird SDG 2 anhand zweier Indikatoren gemessen: dem Stickstoffüberschuss und dem Anteil von ökologischem Landbau an der gesamten Landwirtschaft.
Durch Düngung landwirtschaftlicher Flächen oder durch Futtermittel wird Stickstoff in die Umwelt eingetragen und belastet die Gewässer und Ökosysteme. Ziel ist es, für den Zeitraum 2028 bis 2032 die Stickstoffüberschüsse im Mittel auf 70 Kilogramm je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche pro Jahr zu verringern. Von Anfang der 1990er-Jahre bis 2011 sank der Stickstoffüberschuss kontinuierlich, stagniert seither jedoch bei 93 Kilogramm je Hektar. Wird hier nichts unternommen, wird das Ziel bis 2032 nicht erreicht werden.
Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil landwirtschaftlicher Flächen unter ökologischer Bewirtschaftung in Deutschland 20 Prozent betragen. 2019 waren es je nach Berechnung zwischen 7,8 und 9,7 Prozent. Zwar ist der Anteil kontinuierlich angestiegen. Doch auch hier muss deutlich mehr getan werden, um das Ziel bis 2030 zu erreichen (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).
Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ erweitert die Indikatoren um drei weitere: den Fleischkonsum pro Kopf, den Antibiotika- und den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft. Bei den offiziellen Indikatoren errechnet „2030 Watch“ einen Fortschritt von 48,5 Prozent. Nimmt man die zusätzlichen Indikatoren hinzu, kommt das zivilgesellschaftliche Monitoring zu einem Fortschritt von 52,4 Prozent, also zu einem besseren Ergebnis.
Die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums aus dem Jahr 2020 betont zudem, dass in reicheren Ländern wie Deutschland die Verschwendung von Lebensmitteln ein großes Problem darstellt. Im Jahr 2020 gab es in Deutschland elf Millionen Tonnen an Lebensmittelabfällen, der Großteil davon in privaten Haushalten. Jährlich werfen wir 78 Kilogramm Lebensmittel weg. Doch nicht alles davon sind wirklich Abfälle oder Verdorbenes, sondern könnte noch verwendet werden (Quelle: BMEL). Die Verschwendung von Lebensmitteln wird auch in SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion) thematisiert.
#3 Gesundheit und Wohlergehen

Ziel ist es, bis 2030 ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters zu gewährleisten und ihr Wohlergehen zu fördern.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Senkung der Sterblichkeit von Müttern und Kindern
- Schutz vor übertragbaren Krankheiten wie Tuberkulose und Aids sowie vor Zivilisationskrankheiten wie Krebs oder Diabetes für alle Menschen
- Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten, Medikamenten und Impfstoffen ohne finanzielle Nöte für alle Menschen
- Recht auf Selbstbestimmung in der Familienplanung für Mädchen und Frauen sowie Zugang zu Verhütungsmitteln
- Senkung des Risikos für nationale und internationale Gesundheitskrisen
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
COVID-19 hat die Fortschritte in der weltweiten Gesundheitsversorgung geschmälert. Vor der Pandemie gab es sichtbare Verbesserungen etwa bei der Gesundheit von Müttern und Kindern oder der Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Durch die Pandemie wurden grundlegende Gesundheitsdienste schwer beeinträchtigt, der Impfschutz sank erstmals seit zehn Jahren, die Zahl der Tuberkulose- und Malaria-Toten stieg an.
COVID-19 kostete schätzungsweise 15 Millionen Menschen bis Ende 2021 zusätzlich das Leben. Insgesamt hatten sich mehr als 500 Millionen Menschen bis Mitte 2022 infiziert. Die Pandemie beeinträchtigte weltweit die Gesundheitssysteme und grundlegenden Gesundheitsdienste wie die Gesundheit von Müttern und Kindern, den Impfschutz, Programme für psychische Gesundheit oder die Behandlung von Infektionskrankheiten wie HIV, Tuberkulose oder Malaria. In vielen Ländern ist die Lebenserwartung um ein bis zwei Jahre gesunken. Bis heute ist der Zugang zu Impfstoff gegen COVID-19 auf der Welt ungleich verteilt: Im Mai 2022 hatten nur etwa 17 Prozent der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen mindestens eine Impfdosis erhalten, in Ländern mit hohem Einkommen dagegen mehr als 80 Prozent.
Die Pandemie ließ Angstzustände und Depressionen vor allem bei jungen Menschen deutlich steigen: Schon vor der Pandemie, 2019, hatten 86 Millionen Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren und 80 Millionen Kinder zwischen 10 und 14 Jahren – mehr als 13 Prozent der Angehörigen der zwei Altersgruppen – eine diagnostizierte psychische Störung. Die Pandemie hat diese Situation massiv verschärft. Hier brauche es vermehrte Aufmerksamkeit und Investitionen, so der Sustainable Development Goals Report 2022.
Die Gesundheit von Müttern und Kindern kommt voran, jedoch mit regionalen Unterschieden: Es gibt mehr Personal in der Geburtshilfe, die Sterblichkeitsrate von Neugeborenen ging um 12 Prozent, von Kindern unter fünf Jahren um 14 Prozent zwischen 2015 und 2020 zurück. Die höchste Sterblichkeit hat immer noch Afrika südlich der Sahara. Auch die Geburtenrate von Jugendlichen sank weltweit.
Die Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie Aids, Tuberkulose oder Malaria erlitt durch die Pandemie einen herben Rückschlag: Wieder mehr Menschen infizierten sich und starben an diesen und weiteren Infektionskrankheiten. Außerdem versäumten in der Pandemie wieder mehr Kinder grundlegende Impfungen. Der Impfschutz sank erstmals seit 2005.

Wo steht Deutschland?
Die vorzeitige Sterblichkeit von Frauen und Männern ist zwar gesunken, aber nicht so stark wie erhofft. Bei der Raucher:innenquote hatte man das Ziel fast erreicht. Doch aktuell steigt die Zahl der Raucher:innen wieder an. Auch die Adipositasquote bei Erwachsenen ist in den letzten Jahren gestiegen, bei Kindern und Jugendlichen dagegen konstant geblieben. Fortschritte werden dagegen bei der Reduktion von Emissionen von Luftschadstoffen und Feinstaub verzeichnet.
In Deutschland wird SDG 3 anhand verschiedener Indikatoren gemessen:
- Vorzeitige Sterblichkeit unter 70 Jahren: Bis 2030 soll die vorzeitige Sterblichkeit bei Frauen bei höchstens 100 und bei Männern bei höchstens 190 Todesfällen je 100.000 Einwohner:innen liegen. 2018 waren es 151 Frauen und 279 Männer. Der Rückgang in den vergangenen drei Jahrzehnten ist zwar deutlich. Dennoch würde bei gleichbleibender Entwicklung das Ziel bis 2030 verfehlt. Ursachen für eine vorzeitige Sterblichkeit sind vor allem Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die insgesamte Lebenserwartung in Deutschland ist jedoch gestiegen.
- Raucherquote: Bis 2030 soll die Raucherquote bei Jugendlichen auf sieben Prozent, bei Personen ab 15 Jahren auf 19 Prozent sinken. Das war fast geschafft: Nur sechs Prozent der Jugendlichen rauchte 2019, 22 Prozent der Personen ab 15 Jahren. Allerdings ergab die repräsentative Langzeitstudie DEBRA, dass der Anteil der Raucher:innen unter den 14- bis 17-Jährigen in 2022 sprunghaft auf 15,9 Prozent angestiegen ist. 2021 waren es noch 8,7 Prozent.
- Adipositasquote: Ziel der Bundesregierung ist es, dass die Adipositasquoten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis 2030 nicht weiter ansteigen. Bei Kindern zwischen drei und zehn Jahren sowie Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren ist dies der Fall, die Quoten haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten kaum verändert und lagen 2017 bei rund 12 bzw. knapp 19 Prozent. Bei Erwachsenen ist in den vergangenen Jahren allerdings ein Anstieg von 11 (1999) auf 15 Prozent (2017) zu verzeichnen, eine Entwicklung konträr zur Nachhaltigkeitsstrategie.
- Luftschadstoffe und Feinstaub: Luftverunreinigungen beeinträchtigen nicht nur die Gesundheit der Menschen, sondern auch Ökosysteme und Artenvielfalt. Die Emissionen von Luftschadstoffen sollen daher bis zum Jahr 2030 um 45 Prozent gegenüber dem Jahr 2005 sinken. Bis 2018 gingen die Luftverunreinigungen um rund 25 Prozent im Vergleich zu 2005 zurück. Bei gleichbleibender Entwickung würde das Ziel erreicht werden. Beim Feinstaub soll es bis 2030 gelingen, dass kein Mensch einer Feinstaubkonzentration von mehr als 20 Mikrogramm je Kubikmeter Luft ausgesetzt ist. Zwischen 2007 und 2018 ist die Feinstaubexposition deutlich gesunken und das Ziel sollte erreicht werden (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).
Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ erweitert die Indikatoren um die Suizidrate und den Alkoholkonsum, der nach wie vor in Deutschland viel zu hoch liegt. Bei den offiziellen Indikatoren errechnet „2030 Watch“ einen Fortschritt von 58,5 Prozent. Nimmt man die zusätzlichen Indikatoren hinzu, kommt das zivilgesellschaftliche Monitoring zu einem Fortschritt von 54,7 Prozent, also zu einem ähnlichen Ergebnis.
#4 Hochwertige Bildung

Bildung ist ein Menschenrecht und zentrale Voraussetzung für die Überwindung von Armut und ein selbstbestimmtes Leben. Ziel ist es daher, bis 2030 eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewährleisten und die Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle zu fördern.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Gleichberechtigter Bildungszugang für alle
- Zugang zu frühkindlicher Bildung
- Kostenlose, gerechte und hochwertige Grund- und Sekundarbildung für alle Mädchen und Jungen
- Zugang zu hochwertiger beruflicher Bildung und Hochschulbildung
- Alle Jugendliche und mehr Erwachsene sollen lesen, schreiben und rechnen können
- Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
Die Corona-Pandemie hat auch den Bildungssektor hart getroffen: Etwa 147 Millionen Kinder versäumten in 2020 und 2021 über die Hälfte ihres Präsenzunterrichts. Je länger Kinder nicht in die Schule gehen, desto unwahrscheinlicher ist ihre Rückkehr. Die Abbrecherquoten steigen, ebenso die Lernrückstände. Bildungsdisparitäten zwischen den Geschlechtern, aber auch zwischen Kindern aus ärmeren und reicheren Ländern bzw. Familien sind gewachsen.
Vor der Pandemie war die Zahl der Kinder, die keine Schule besuchen, von 26 Prozent im Jahr 2000 auf 17 Prozent im Jahr 2019 gesunken. Dieser positive Trend hat sich seit der Pandemie gedreht. Denn von März 2020 bis Februar 2022 waren die Schulen in aller Welt durchschnittlich 41 Wochen lang ganz oder teilweise geschlossen. Doch je länger Schulen geschlossen haben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Kinder zur Schule zurückkehren, weil es sich Eltern vielfach nicht mehr leisten können, ihre Kinder auf die Schule zu schicken und die Kinder durch Arbeit selbst etwas zum Lebensunterhalt beitragen müssen.
Schulschließungen und Unterrichtsausfälle führten überdies zu schlechteren Lernergebnissen, was besonders in den elementaren Grundkenntnissen des Schreibens, Lesens und Rechnens fatal ist. Außerdem haben die Schulschließungen die
Ungleichheit im Bildungsbereich verschärft: Kinder aus ärmeren Ländern oder einkommensschwachen Familien sowie Mädchen und Kinder mit Behinderungen sind von Lernrückständen in besonderem Maß betroffen. Hier brauche es ambitionierte Programme, um allen Kindern eine Rückkehr in die Schule und das Aufholen ihres Lernrückstands zu ermöglichen, so der Sustainable Development Goals Report 2022. Außerdem haben nach wie vor rund ein Viertel aller Schulen weltweit keinen Zugang zu Strom, Trinkwasser und grundlegenden sanitären Einrichtungen. Etwa der Hälfte fehlt eine Ausstattung mit Computern und Internetanschlüssen sowie barrierefreie Zugänge für Kinder mit Behinderung.

Wo steht Deutschland?
In Deutschland steigt die Zahl derjenigen Personen zwischen 18 und 24 Jahren, die weder über Abitur oder Fachhochschulreife noch eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, seit einigen Jahren wieder an und entwickelt sich damit gegenläufig zum erwünschten Ziel. Dagegen bewegt sich der Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit akademischem oder beruflich höher qualifiziertem Abschluss in die gewünschte Richtung. Auch die Zahl der Kinder in Ganztagsbetreuung wächst, doch nicht in dem Maße, um die gesteckten Ziele bis 2030 zu erreichen.
Die Coronakrise hat die Defizite im deutschen Bildungssystem schonungslos offengelegt, vor allem im Hinblick auf den Investitionsstau beim Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen. Zudem führten Schulschließungen auch hierzulande zu schlechteren Lernergebnissen und Lernrückständen. Die Bildungsdisparitäten zwischen Kindern aus einkommensschwachen und einkommensstarken Familien verschärften sich (Quelle: 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums).
Generell misst Deutschland SDG 4 anhand folgender Indikatoren:
- Frühe Schulabgänger:innen: Dies sind diejenigen Personen zwischen 18 und 24 Jahren, die weder über Abitur oder Fachhochschulreife noch eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und sich auch nicht in Aus- oder Weiterbildung befinden. Ziel ist es, deren Anteil auf 9,5 Prozent bis 2030 zu senken. Doch der Trend läuft in die entgegengesetzte Richtung: Seit 2014 steigt die Zahl der frühen Schulabgänger:innen wieder an auf aktuell 10,3 Prozent.
- Akademisch Qualifizierte und beruflich Höherqualifizierte: Unter den 30- bis 34-Jährigen befinden sich immer mehr Menschen mit einem akademischen oder beruflich höher qualifizierten Abschluss (z.B. Meisterabschluss). 2019 waren es 50,5 Prozent. Ziel bis 2030 sind 55 Prozent, weshalb von einer Zielerreichung auszugehen ist.
- Ganztagsbetreuung: Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Chancengerechtigkeit und eine verbesserte Integration ist die Ganztagsbetreuung von Kindern zentral. Zwar wächst die Zahl der Kinder in Ganztagsbetreuung. 2020 waren es 17,1 Prozent der 0- bis 2-Jährigen und 47,6 Prozent der 3- bis 5-Jährigen. Doch der Ausbau der Ganztagsbetreuung gelingt nicht in dem Maße, um die gesteckten Ziele bis 2030 (35 Prozent der 0- bis 2-Jährigen, 70 Prozent der 3- bis 5-Jährigen) zu erreichen (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).
Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ nimmt die beiden Indikatoren Bildungsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) und den Einfluss von sozioökonomischen Faktoren auf den Bildungsgrad hinzu und kommt so auf einen Fortschritt von 48,7 Prozent gegenüber 55,2 Prozent, wenn man nur die offiziellen Indikatoren berücksichtigt.
#5 Geschlechtergleichheit

Mit dem SDG 5 möchte die Weltgemeinschaft bis 2030 Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Beseitigung aller Formen von Diskriminierung
- Beendigung aller Formen von Gewalt gegen und die Ausbeutung von Frauen und Mädchen
- Keine Kinderheirat, Zwangsverheiratung und weibliche Genitalverstümmlung mehr
- Anerkennung von unbezahlter Pflege- und Hausarbeit
- Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft; mehr Frauen in Führungspositionen
- Ungehinderter Zugang zu Gesundheitsleistungen, auch der sexuellen und reproduktiven Gesundheit
- Gleiche Rechte auf und Zugang zu Land, Eigentum, finanzielle Dienstleistungen und Technologien für Frauen und Mädchen
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist immer noch ein weiter Weg und auch hier hat die Corona-Pandemie traditionelle Geschlechterrollen befördert und Fortschritte zunichte gemacht. Gewalt gegen Frauen und Mädchen gibt es in allen Ländern. Frauen sind gesundheitlich schlechter gestellt, besitzen selten Land, verdienen weniger und besetzen seltener Führungspositionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Weltweit hat eine von vier Frauen und Mädchen ab 15 Jahren mindestens einmal in ihrem Leben körperliche und/oder sexuelle Gewalt in Ehe oder Partnerschaft erfahren. In vielen Ländern haben Frauen keinen Rechtsanspruch, frei über ihren Körper zu bestimmen und selbst über die Inanspruchnahme von Gesundheitsversorgung und Verhütungsmitteln zu entscheiden. Daten weisen auf eine Verschärfung dieser Situation in der Corona-Pandemie hin.
Kinderehen und Genitalverstümmelung sind in vielen Ländern nach wie vor gängige Praxis: 2021 war fast jede fünfte junge Frau vor ihrem vollendeten 18. Lebensjahr verheiratet. Am häufigsten sind Kinderheiraten in Afrika südlich der Sahara und in Südasien. Mindestens 200 Millionen der heute lebenden Mädchen und Frauen wurden einer Verstümmelung ihrer Genitalien unterzogen. Bildung ist hier das zentrale Instrument, um dieser menschenverachtenden Praxis entgegenzutreten. Denn Frauen und Mädchen mit Bildung werden um 40 Prozent seltener beschnitten.
Noch immer sind zu wenig Frauen in Führungspositonen in Politik und Wirtschaft vertreten und die Fortschritte sind nur schleppend: Weltweit lag der Frauenanteil in nationalen Parlamenten Anfang 2022 bei 26,2 Prozent gegenüber 22,4 Prozent im Jahr 2015. Der Frauenanteil in Führungspositionen stieg global zwischen 2015 und 2019 nur leicht von 27,2
auf 28,3 Prozent und blieb von 2019 auf 2020 unverändert. (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?
Auch in Deutschland ist man von Gleichberechtigung noch weit entfernt: Noch immer verdienen Frauen rund 18 Prozent weniger als Männer. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland hier auf einem der letzten Plätze. Über ein Drittel des Top-Managements von großen Konzernen besteht mittlerweile aus Frauen, in Wirtschaftsunternehmen generell liegt der Anteil jedoch nur bei 22 Prozent. Auch bei der gleichberechtigten Aufteilung von Kinderbetreuung und Care-Arbeit ist Luft nach oben.
In Deutschland wird SDG 5 anhand folgender Indikatoren gemessen:
- Gender Pay Gap: Noch immer verdienen Frauen in Deutschland rund 18 Prozent weniger als Männer (Quelle: Statistisches Bundesamt). Ziel war es, bereits 2020 den Gender Pay Gap auf zehn Prozent zu verringern und diesen Wert bis 2030 zu halten. Im jetzigen Tempo wird dieses Ziel nicht erreicht. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland auf einem der letzten Plätze.
- Frauen in Führungspositionen: Im Top Management von börsennotierten Unternehmen waren 2020 über ein Drittel (35,2 Prozent) Frauen, in Wirtschaftsunternehmen generell lag der Wert allerdings nur bei 22 Prozent. Im Öffentlichen Dienst des Bundes arbeiteten 2019 37,6 Prozent Frauen. Damit wurde der Zielwert von 30 Prozent zwar überschritten. Von einer Gleichberechtigung kann jedoch nicht die Rede sein.
- Väterbeteiligung beim Elterngeld: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollte für Frauen und Männer gleichermaßen möglich sein. Ein Indikator dafür ist das Elterngeld. Ziel ist es, dass sich bis 2030 der Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld beziehen, auf 65 Prozent steigert. Aktuell sind es rund 40 Prozent (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).
Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ nimmt unter anderem die Indikatoren Frauenanteil in Parlamenten, Gender Gap im Renteneinkommen und die ungleiche Verteilung der Hausarbeit hinzu und kommt damit auf einen Fortschritt von rund 90 Prozent, während sich aus den offiziellen Indikatoren bereits einer Übererfüllung der Ziele ergeben würde. Betrachtet man beispielsweise den Frauenanteil in Parlamenten, so zeigt sich, dass nur 35 Prozent der Abgeordneten im Deutschen Bundestag Frauen sind.
LpB-Angebote zu SDG 5

8. März: Internationaler Frauentag
Online-Dossier
Beim Anteil weiblicher Abgeordneter nimmt der baden-württembergische Landtag eine Schlusslicht-Position ein: 35 von derzeit 143 Parlamentariern sind Frauen.
Frauen in den Länderparlamenten
Online-Dossier
Beim Anteil weiblicher Abgeordneter nimmt der baden-württembergische Landtag eine Schlusslicht-Position ein: 35 von derzeit 143 Parlamentariern sind Frauen.
Equal Pay Day – Entgeltgleichheit für Männer und Frauen
Online-Dossier
Der Aktionstag will auf den Unterschied im Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern (Gender Pay Gap) aufmerksam machen.
Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen
Online-Dossier
Jede vierte Frau hat mindestens einmal in ihrem Leben Partnerschaftsgewalt erlebt. Gewalt ist traurige Wirklichkeit für viele Frauen mitten in der Gesellschaft.

Diversity und Gender Mainstreaming
Online-Dossier
Mit Diversity soll die Vielfalt in unserer Gesellschaft aufgezeigt werden. Gender Mainstreaming bezeichnet die Verpflichtung, bei allen Entscheidungen die Auswirkungen auf Männer und Frauen in den Blick zu nehmen.

Mit Gender Mainstreaming zur Chancengleichheit
E-Learning-Kurs
In diesem vierwöchigen E-Learning-Kurs erfahren Sie, was Gender Mainstreaming bedeutet und wie Sie Gender Mainstreaming bei Ihnen im Öffentlichen Dienst umsetzen können.
#6 Sauberes Wasser
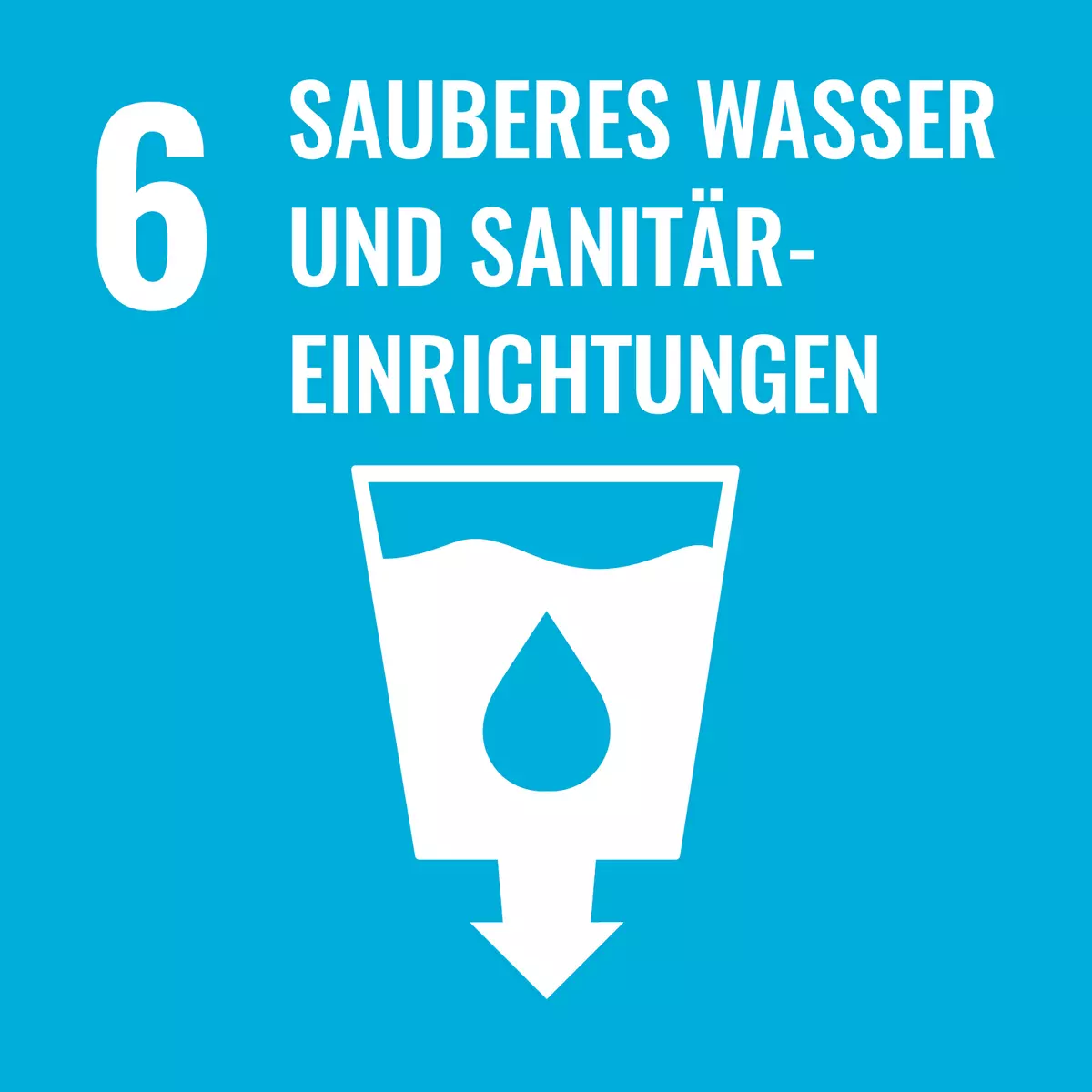
Ziel ist es, bis 2030 die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und eine Sanitärversorgung für alle zu gewährleisten.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Zugang zu sicherem und bezahlbarem Trinkwasser für alle Menschen
- Angemessene Sanitärversorgung und Hygiene für alle Menschen
- Verbesserung der Wasserqualität
- Effiziente und nachhaltige Wassernutzung und integriertes Wassermanagement
- Schutz und Wiederherstellung von Wasserökosystemen
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
2,2 Milliarden Menschen haben nach wie vor keinen Zugang zu sicherem und bezahlbarem Trinkwasser, 3,6 Milliarden keinen Zugang zu Sanitäreinrichtungen. Die Fortschritte reichen nicht aus, um das Ziel bis 2030 zu erreichen. Generell nimmt die Wasserknappheit aufgrund von Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum und wegen des Klimawandels zu: Die UNESCO schätzt, dass 2050 über 40 Prozent der Weltbevölkerung unter Wassermangel leiden werden.
Noch immer haben über zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem und sauberem Trinkwasser. 3,6 Milliarden Menschen fehlt der Zugang zu Sanitäreinrichtungen. Die Weltgemeinschaft tut zu wenig, um SDG 6 zu erreichen. Schätzungen zufolge werden 2030 noch immer 1,6 Milliarden Menschen ohne Zugang zu Trinkwasser und 2,8 Milliarden Menschen ohne Zugang zu Sanitäranlagen sein. Für einen universellen Zugang müssten die aktuellen Fortschritte um das Vierfache gesteigert werden.
Das Recht auf Wasser ist ein Menschenrecht. Doch Wasser ist ein knappes Gut. Durch Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum greifen immer mehr Menschen auf diese begrenzte Ressource zu. Die Folgen des Klimawandels mit Dürreperioden und Starkregenereignissen sorgen für eine weitere Verknappung. Wasserstress tritt dann ein, wenn das Verhältnis des entnommenen Süßwassers zu den gesamten erneuerbaren Süßwasserressourcen über 25 Prozent liegt. 2019 lag der Wert weltweit bei 18,6 Prozent. Doch der Wasserstress in vielen Regionen der Welt, vor allem in Nordafrika und Westasien, nimmt zu und führt zu negativen Auswirkungen auf die wirtschafliche und soziale Entwicklung. Die UNESCO schätzt, dass bis 2050 über 40 Prozent der Weltbevölkerung unter schwerem Wassermangel leiden werden (Quelle: 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums). Daher bedarf es einer effizienteren Wassernutzung und eines integrierten Wassermanagements, auch über Grenzen hinweg, um eine Wasserversorgung für alle zu sichern und Konflikten um Wasser vorzubeugen.
Bei SDG 6 geht es aber nicht nur um den gerechten Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung, sondern auch um die ökologischen Aspekte von Wasser. So spielt der Schutz und die Wiederherstellung von Wasserökosystemen wie Feuchtgebieten, Seen, Flüssen und Ozeanen eine zentrale Rolle im Kampf gegen den Klimawandel und zur Erhaltung der Biodiversität auf unserem Planeten (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?
In Deutschland spielt Wasserknappheit (noch) keine so gravierende Rolle wie in anderen Ländern. Doch Hitzeperioden und Starkregenereignisse bereiten auch uns und unserer Landwirtschaft immer mehr Probleme. Zudem macht der hohe Eintrag von Phosphor und Nitrat in unsere Gewässer und ins Grundwasser unserem Trinkwasser und unseren Wasserökosystemen zu schaffen. Auch der globale Wasserfußabdruck Deutschlands ist enorm.
In Deutschland wird SDG 6 anhand von Phosphor in Fließgewässern und Nitrat im Grundwasser gemessen. Zu viel Phosphor in unseren Flüssen sorgt für Algenwachstum und Fischsterben. Unter anderem durch stickstoffhaltige Düngung gelangt zuviel Nitrat in unser Grundwasser und belastet die Wasserqualität. Zwar hat sich der Anteil der Messstellen, an denen der Orientierungswert für Phosphor eingehalten wird, in den letzten drei Jahrzehnten mehr als verdoppelt und lag 2018 bei rund 44 Prozent. Beim Nitratgehalt hat sich in den vergangenen zehn Jahren dagegen wenig getan. Noch immer weisen 17,5 Prozent der Messstellen Nitratgehalte über dem Schwellenwert auf (Quelle: Nitratbericht 2020). Doch Ziel ist es eigentlich, bis 2030 an allen Messstellen die Werte für Phosphor- und Nitratgehalte einzuhalten (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).
Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ würde gern den ökologischen Zustand unserer Seen und Flüsse als weitere Indikatoren hinzunehmen, bemängelt aber die fehlende Datenlage in diesen Bereichen. Die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums zu den Fortschritten bei der Zielerreichung aus dem Jahr 2020 macht überdies auf den großen globalen Wasserfußabdruck Deutschlands aufmerksam. Denn indirekt verwenden wir als Konsument:innen sehr viel Wasser. Hinter der indirekten Wassernutzung steckt diejenige Wassermenge, die bei der Produktion unserer Konsumgüter und Lebensmittel, die oft im Ausland hergestellt werden, verbraucht wird. Man spricht hier auch von virtuellem Wasser. Unser sogenannter „Wasserfußabdruck“ ist deshalb sehr groß und betug 2022 pro Kopf 7.200 Liter täglich. Das entspricht 48 gefüllten Badewannen (Quelle: ZDF online)!
LpB-Dossier zu SDG 6

Weltwassertag: Unser Wasser
Wird das Wasser knapp?
Wasser ist für viele ein selbstverständliches Gut. Aber wie lange noch? Denn die Wasserknappheit in anderen Ländern und hierzulande nimmt zu. Wie ist die Situation weltweit und in Deutschland? Unser Dossier klärt auf.
#7 Bezahlbare und saubere Energie

Ziel ist es, bis 2030 den Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle zu sichern.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und moderner Energie für alle Menschen
- Deutliche Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien
- Verdopplung der weltweiten Steigerungsrate der Energieeffizienz
- Mehr internationale Zusammenarbeit bei Forschung und Technik im Bereich saubere Energie
- Mehr Investitionen in Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien
- Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur für nachhaltige Energiedienstleistungen in Ländern des globalen Südens
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
91 Prozent aller Menschen auf der Welt hatten 2020 Zugang zu Strom. Doch die Fortschritte, um die am schwersten zu erreichenden Menschen mit Elektrizität zu versorgen, verlangsamen sich. Noch immer nutzen 2,4 Milliarden Menschen ineffiziente Kochsysteme, die die Gesundheit und die Umwelt belasten. Der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt ebenfalls nur schleppend voran. Die Zielvorgabe in Bezug auf die Energieeffizienz könnte noch erreicht werden, allerdings nur mit massiven Investitionen.
Bis 2030 soll allen Menschen der Zugang zu Strom ermöglicht werden. 2020 waren es bereits 91 Prozent. Doch die Fortschritte, um die am schwersten zu erreichenden Menschen mit Elektrizität zu versorgen, verlangsamen sich. Vor allem Menschen in afrikanischen Ländern südlich der Sahara leben nach wie vor ohne Strom. Bleibt das jetzige Tempo bestehen, werden 2030 nur 92 Prozent der Menschen Zugang zu Elektrizität haben, 670 Millionen Menschen bleiben unversorgt.
Ein weiteres Ziel ist die Versorgung der Menschen mit sauberen Brennstoffen und Technologien zum Kochen. Noch immer nutzen 2,4 Milliarden Menschen ineffiziente Kochsysteme, die die Gesundheit und die Umwelt belasten. Fortschritte gab es in den letzten Jahren vor allem in Brasilien, China, Indien, Indonesien und Pakistan. Nach aktuellen Trends werden bis 2030 nur 76 Prozent der Weltbevölkerung Zugang zu den sauberen Brennstoffen und Kochtechnologien haben.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt ebenfalls nur schleppend voran, eine der Schlüsselfaktoren im Kampf gegen den Klimawandel. Der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieendverbrauch erreichte 2019 knapp 18 Prozent und lag damit um 1,6 Prozentpunkte über dem Wert von 2010. Der Gesamtverbrauch an erneuerbaren Energien stieg in diesem Zeitraum jedoch um ein Viertel. Hier sind enorme Anstrengungen und Unterstützung der Entwicklungsländer vonnöten, um die Klimaziele doch noch zu erreichen. Leider sind die internationalen Finanzströme für saubere Energien vor allem in der Corona-Pandemie ins Stocken geraten.
Auch eine höhere Energieeffizienz ist für die Erreichung der Klimaziele zentral. Die Zielvorgabe bis 2030 könnte noch erreicht werden, allerdings nur, wenn sich die Energieintensität bis 2030 jedes Jahr um durchschnittlich 3,2 Prozent verbessert. Aktuell sind es 1,9 Prozent. Massive und systematische Investitionen sind daher notwendig (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?
Deutschland hat sich im April 2023 von der Atomenergie verabschiedet, bis 2038 soll der Kohleausstieg erfolgen, 2045 Treibhausgasneutralität erreicht werden. Für die Energiewende sind mehr Energieeffizienz, weniger Energieverbrauch und eine Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien zentral. Während es beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorangeht und die Ziele eingehalten werden, verfehlt Deutschland bisher die Zielmarken bei Energieverbrauch und Effizienzsteigerung.
Die Senkung des Energieverbrauchs durch eine Steigerung der Energieeffizienz und der Ausbau erneuerbarer Energien sind die zwei tragenden Säulen der Energiewende in Deutschland. Daher wird SDG 7 anhand folgender Indikatoren gemessen:
- Endenergieproduktivität und Primärenergieverbrauch: Beide Indikatoren stehen in direktem Zusammenhang zueinander. Ziel ist es, die Endenergieproduktivität in den Jahren 2008 bis 2050 jährlich um 2,1 Prozent zu erhöhen und gleichzeitig den Primärenergieverbrauch bis 2030 um 30 Prozent und bis 2050 um 50 Prozent gegenüber dem Jahr 2008 zu verringern. Das ist bisher nicht geschafft: Die Endenergieproduktivität hat sich bis 2019 um 15,4 Prozent erhöht, was einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von rund 1,4 Prozent entspricht. Angestrebt werden jedoch jährlich 2,1 Prozent. Der Primärenergieverbrauch hat sich zwischen 2008 und 2019 um rund 11 Prozent reduziert. In einem Zwischenziel waren bis 2020 jedoch 20 Prozent angestrebt gewesen. Es bedarf daher größerer Anstrengungen, um Energie effizienter zu nutzen und den Verbrauch stärker zu senken.
- Anteil der erneuerbaren Energien: Ziel ist es, den Anteil der erneuerbaren Energien am Brutto-Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 18 Prozent, bis 2030 auf 30 Prozent, bis 2040 auf 45 Prozent und bis 2050 auf 60 Prozent zu erhöhen. 2019 betrug der Anteil knapp 18 Prozent, womit man die Zielmarke für 2020 erreicht hat.
- Auch beim Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch sieht es gut aus: Bis 2020 sollte der Anteil auf 35 Prozent, bis 2030 soll auf 65 Prozent steigen und noch vor 2050 soll der gesamte Strom treibhausneutral erzeugt und verbraucht werden. 2020 lag der Anteil bereits bei über 45 Prozent (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021). Dennoch machen Wissenschaftler:innen deutlich, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem der Windkraft, noch einiges an Fahrt aufnehmen muss, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Zudem brauche es große finanzielle Anstrengungen, um die globale Energiewende zu meistern. Hier benötigen die Länder des globalen Südens finanzielle und technische Unterstützung durch die Industrienationen (Quelle: 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums).
Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ nimmt die Indikatoren CO2-Emissionen und Energieverbrauch pro Kopf sowie die Subvention fossiler Brennstoffe hinzu. Mit diesen zusätzlichen Indikatoren kommt „2030 Watch“ sogar zu einem höheren Fortschritt, nämlich 55 Prozent, als beim offiziellen Monitoring (51 Prozent).
#8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Ziel ist es, bis 2030 ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Menschen zu fördern.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Mindestens sieben Prozent jährliches Wirtschaftswachstum in weniger entwickelten Ländern
- Mehr wirtschaftliche Produktivität und stärkerer Einbezug von Frauen ins Wirtschaftssystem
- Verbesserter Zugang zu bedarfsgerechten Finanzdienstleistungen für kleine und mittlere, insbesondere frauengeführte, Unternehmen
- Stärkung der Kapazität inländischer Finanzinstitutionen
- Entkopplung von Wirtschaftsleistung und Wohlstand vom Ressourcenverbrauch
- Menschenwürdige Arbeit und Vollbeschäftigung für alle Menschen
- Abschaffung von Zwangsarbeit und Menschenhandel
- Keine Kinderarbeit mehr bis 2025
- Förderung von nachhaltigem Tourismus
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
Erst stürzte die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft in eine schwere Krise, von der sich vor allem die am wenigsten entwickelten Länder am langsamsten erholen. Nun bremst der Krieg in der Ukraine das weltweite Wirtschaftswachstum. Die Arbeitsproduktivität ist vor allem bei kleinen Unternehmen und in ärmeren Ländern gesunken. Auch die Erholung am Arbeitsmarkt bleibt weiterhin labil. Außerdem geht man davon aus, dass die Folgen der Pandemie Millionen von Kindern in die Kinderarbeit getrieben hat.
Nach der Corona-Pandemie erholt sich die Weltwirtschaft nur langsam und der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bremst die Entwicklung zusätzlich. Eigentlich sieht das SDG 8 ein jährliches Wirtschaftswachstum von sieben Prozent in weniger entwickelten Ländern vor. In der Corona-Pandemie gab es in diesen Ländern kaum Wachstum, für 2022 wird ein Zuwachs von vier Prozent und für 2023 von 5,7 Prozent erwartet. Bei der Arbeitsproduktivität führte die Pandemie zu großen Schwankungen: Während die Produktion pro Beschäftigtem in 2021 in Ländern mit hohem Einkommen wieder deutlich anzog, sank sie in Entwicklungsländern. Hiervon waren vor allem kleine Unternehmen betroffen.
Die Erholung des Arbeitsmarkts schreitet ebenfalls nur schleppend voran. Die globale Arbeitslosenquote bleibt Schätzungen zufolge auch 2023 noch über den 5,4 Prozent von 2019. 2021 waren noch immer 28 Millionen mehr Menschen als 2019 arbeitslos. Von Arbeitslosigkeit sind vor allem Frauen, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen betroffen. So war auch die allgemeine und berufliche Bildung von Jugendlichen durch die Pandemie stark eingeschränkt. Viele Jugendliche fingen erst gar keine Ausbildung an oder brachen sie ab. 2020 betrug der Anteil von Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren, die weder eine allgemeine oder berufliche Bildung durchlaufen noch erwerbstätig sind, weltweit rund 23 Prozent, in Asien und Nordafrika sogar über 30 Prozent.
Anfang 2020 leisteten weltweit 160 Millionen Kinder Kinderarbeit. Das ist fast jedes zehnte Kind. Man schätzt, dass aufgrund der pandemiebedingt steigenden Armut bis Ende 2022 weltweit neun Millionen Kinder mehr als 2020 in Kinderarbeit gedrängt worden sein könnten (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?
Auch wenn sich die deutsche Wirtschaft von der Corona-Pandemie im Vergleich mit anderen Ländern gut erholt, stiegen die öffentlichen Schulden in 2022 auf einen neuen Höchstwert von 2,37 Billionen Euro (Quelle: Statistisches Bundesamt), eine Belastung für künftige Generationen. Bruttoinlandsprodukt und Investitionsquoten entwickelten sich im Trend positiv, ebenso die Erwerbstätigenquote. Allerdings gibt es in Deutschland immer noch Millionen Menschen, die zwar arbeiten, davon aber nicht leben können.
Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird anhand von sechs Indikatoren gemessen:
- Gesamtrohstoffproduktivität: Durch die Entnahme von Rohstoffen zur Produktion von Gütern wird stets die Natur beeinträchtigt. Daher hat sich Deutschland das Ziel gesetzt, die Gesamtrohstoffproduktivität zu steigern. Diese nahm zwischen 2000 und 2010 bereits um durchschnittlich 1,6 Prozent jährlich zu. Dieser positive Trend soll bis zum Jahr 2030 fortgesetzt werden.
- Staatsdefizit: Gemäß Maastricht-Kriterien der Europäischen Union soll das jährliche Staatsdefizit, bei dem Staatsausgaben den Staatseinnahmen gegenübergestellt werden, weniger als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen. Vor der Corona-Pandemie erwirtschafteten Bund, Länder und Kommunen jährliche Überschüsse und konnten so Schulden tilgen. Doch die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise haben milliardenschwere Löcher in die Staatskassen gerissen. Eine gewisse Entspannung ist jedoch in Sicht: Während die Defizitquote im ersten Halbjahr 2021 noch bei 4,3 Prozent gelegen hatte, verringerte sich diese im ersten Halbjahr 2022 auf 0,7 Prozent (Quelle: Statistisches Bundesamt). Prognosen für die kommenden Jahre sind allerdings schwierig.
- Schuldenstand: Im Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU ist die maximale Schuldenstandsquote auf 60 Prozent des BIP festgelegt, so auch der Indikator der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Nachdem die Schuldenstandsquote im Jahr 2010 mit über 80 Prozent einen Rekordwert erzielt hatte, sank sie ab 2013 kontinuierlich. 2019 wurde mit 59,6 Prozent das erste Mal die gewünschte Schuldenstandsquote erreicht. Doch die Corona-Pandemie trieb die Schulden wieder in die Höhe. 2020 lag die Quote bei 69,8 Prozent, im ersten Quartal 2022 dann bei 68,2 Prozent (Quellen: BFM; Handelsblatt). Im Jahr 2022 stiegen die öffentlichen Schulden auf einen neuen Höchstwert von 2,37 Billionen Euro (Quelle: Statistisches Bundesamt), eine Belastung für künftige Generationen.
- Investitionsquote: Um in Zukunft wirtschaftlich leistungsfähig zu sein, braucht es Investitionen durch Unternehmen und den Staat. Ziel ist daher eine angemessene Entwicklung des Anteils der Bruttoanlageinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt. 2020 lag die Quote bei 22 Prozent. Damit wird der Indikator als positiv ausgewiesen.
- Bruttoinlandsprodukt: Auch beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner:in wünscht man sich ein stetiges und angemessenes Wachstum. Das BIP misst den Wert der im Inland erwirtschafteten Leistung. Mit einem stetigen Aufwärtstrend und 39.000 Euro im Jahr 2019 wird der Indikator positiv ausgewiesen.
- Erwerbstätigenquote: Aufgrund des demografischen Wandels hat Deutschlands Wirtschaft mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Gleichzeitig droht eine finanzielle Unterversorgung der Sozialsysteme. Daher soll die Erwerbstätigenquote der 20- bis 64-Jährigen bis 2030 auf 78 Prozent erhöht werden. Die Erwerbstätigenquote der Älteren (60- bis 64-Jährigen) soll bis dahin 60 Prozent betragen. Mit 80,6 Prozent bzw. 61,8 Prozent wurden diese Zielwerte bereits 2019 überschritten (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).
Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ nimmt fünf weitere Indikatoren in den Blick: Anteil der Arbeitnehmer:innen im Niedriglohnsektor, inländischer Materialverbrauch, Reduktion des inländischen Materialverbrauchs, Armut trotz Vollzeitbeschäftigung und staatliche Maßnahmen gegen Sklaverei. Damit kommt „2030 Watch“ auf einen Fortschritt bei SDG 8 von 38,5 Prozent gegenüber dem offiziellen Monitoringfortschritt von 46,6 Prozent.
Die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums macht vor allem auf die „working poor“ aufmerksam, also Menschen, die zwar arbeiten, aber von ihrer Arbeit trotzdem nicht leben können, auch in Deutschland. So waren 2019 ein knappes Viertel der Hartz IV-Empfänger:innen sogenannte „Aufstocker“. Diese Personen arbeiteten zwar, doch ihr Grundeinkommen war zu niedrig, um die Grundbedürfnisse zu decken. Der Anteil dieser Aufstocker ist seit 2015 trotz besserer wirtschaftlicher Lage nur marginal gesunken. Auf kommunaler Ebene wurde dieser Indikator der Aufstocker deshalb 2018 in das Indikatorenset aufgenommen.
#9 Industrie, Innovation und Infrastruktur

Ziel ist es, bis 2030 eine widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen, eine inklusive, nachhaltige Industrialisierung zu fördern und Innovationen zu unterstützen.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Modernisierung der Infrastruktur und nachhaltige Nachrüstung der Industrien (effizienterer Ressourceneinsatz, Nutzung sauberer Technologien, klimaneutrale Produktion)
- Besserer Zugang kleiner Unternehmen zu Finanzdienstleistungen einschließlich bezahlbarer Kredite und breitere Einbindung in Wertschöpfungsketten und Märkte
- Förderung einer nachhaltigen Industrialisierung in Entwicklungsländern
- Verbesserung und Ausbau von Forschung und Technologien sowie Technologietransfer in weniger entwickelte Länder
- Besserer Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass sich Länder mit einem hohen Technisierungsgrad schneller von der Krise erholten. Weniger entwickelte Länder mit einem geringen Anteil an verarbeitendem Gewerbe bleiben dagegen zurück.
Industrialisierung, technologische Innovationen und eine widerstandsfähige Infrastruktur sind zentrale Faktoren, um sich rasch von einer wirtschaftlichen Krise zu erholen. Das hat die Corona-Pandemie gezeigt. Denn dies gelang Ländern mit hohem Technisierungsgrad wesentlich besser als Ländern mit einem geringen Anteil an verarbeitendem Gewerbe. So stieg der Anteil der Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe am Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen 2015 und 2021 weltweit von 16,2 auf 16,9 Prozent, in den am wenigsten entwickelten Ländern betrug er 2021 jedoch nur 12,5 Prozent. Daher ist es Ziel, die Industrialisierung und Technologisierung in diesen Ländern voranzutreiben und sie so widerstandsfähiger zu machen.
Kleine Unternehmen sind besonders anfällig für Konjunkturschwankungen, weil sie weniger Rücklagen haben und schlechter an Kredite kommen. Viele überlebten die Coronakrise nicht, auch weil die staatliche Unterstützung in ärmeren Ländern teils sehr gering ausfiel oder nicht vorhanden war. Zudem war fast jeder dritte Arbeitsplatz durch COVID-19 beeinträchtigt.
Ein weiterer zentraler Indikator für den Technologiefortschritt ist der Breitbandausbau. 2021 lebten etwa 95 Prozent der Weltbevölkerung in Reichweite eines mobilen Breitbandnetzes. Doch es gibt nach wie vor Lücken vor allem in ländlichen Gebieten. Eigentlich wollte man schon bis 2020 allen Menschen in den am wenigsten entwickelten Ländern einen Zugang zum Internet gewähren. Dieses Ziel wurde jedoch verfehlt (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?
In Deutschland spielen bei SDG 9 die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie der Breitbandausbau eine zentrale Rolle. Bei beiden Indikatoren besteht noch Nachholbedarf, damit Deutschland ein zukunftsfähiger und nachhaltiger Wirtschaftsstandort im globalen Wettbewerb bleibt.
In Deutschland wird SDG 9 anhand der öffentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung und dem Breitbandausbau gemessen:
- Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE): Sie sind ein wichtiger Indikator für das Innovationstempo einer Volkswirtschaft. Ziel ist es, bis 2025 jährlich 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für FuE auszugeben. Auch wenn die Ausgaben 2021 mit knapp 113 Milliarden Euro einen neuen Höchststand erreichten, betrug der Anteil nach wie vor 3,1 Prozent, wie auch schon 2018 (Quelle: Statistisches Bundesamt). Im internationalen Vergleich liegt Deutschland vor den USA oder der EU. Doch Länder wie Schweden oder Japan geben mehr für FuE aus.
- Breitbandausbau: Die flächendeckende Versorgung mit Gigabit-Netzen bis 2025 ist wesentliches Ziel der Bundesregierung, da dies auch einen wichtigen Standortfaktor darstellt. Mitte 2021 hatten rund 78 Prozent der städtischen Haushalte Zugang zu Bandbreitnetzen mit mehr als 1.000 Megabit pro Sekunde, aber nur 23 Prozent in ländlichen Gebieten. Bei der Breitbandversorgung sind neben den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen besser versorgt. Schlusslichter unter den Ländern sind Brandenburg und Sachsen-Anhalt mit unter 30 Prozent. Hier hat Deutschland dringenden Nachholbedarf (Quelle: BMDV). Aufschluss bietet auch der Breitbandatlas der Bundesnetzagentur (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).
Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ nimmt die Indikatoren Open Data Index, Wissenschaftler:innen pro 1.000 Beschäftigte und Wissenstransferbegrenzungen durch Gesetze als weitere Indikatoren hinzu und kommt im Modell auf einen Fortschritt von rund 58 Prozent gegenüber dem offiziellen Fortschritt von 87 Prozent.
Das Global Policy Forum nimmt in ihrer 5-Jahres-Zwischenbilanz aus dem Jahr 2020 außerdem die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland in den Blick und beleuchtet den Anteil des Güterverkehrs mit der Bahn oder Binnenschiffen, denen aus ökologischen Aspekten Vorrang gegenüber der Straße oder dem Flugzeug eingeräumt werden sollte. Doch Deutschland hinkt hier nach wie vor hinterher: 2021 betrug der Güterverkehr per Schiene nur 19 Prozent, in Österreich dagegen 30 Prozent, in Litauen sogar 63 Prozent (Quelle: Statistisches Bundesamt). Die geplante Verkehrswende lässt noch auf sich warten. Bereits bis 2015 wollte man den Güterverkehr per Bahn auf 25 Prozent gesteigert haben.
#10 Weniger Ungleichheiten

Ziel ist es, bis 2030 Ungleichheit in und zwischen Ländern zu verringern. Ungleichheit ist zugleich ein Querschnittsthema in allen SDGs, denn beim Erreichen aller Ziele gilt das Prinzip „Niemanden zurücklassen“.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Das Einkommenswachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung soll nachhaltig erhöht werden
- Gleiche Möglichkeiten für alle Menschen – unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Ethnizität, Religion, Herkunft oder sozialem und wirtschaftlichem Status
- Chancengleichheit durch Abschaffung diskriminierender Gesetze und politischer Praktiken
- Förderung der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Inklusion durch entsprechende Sozial-, Lohn- und Fiskalpolitik
- Geordnete und sichere Migration durch gesteuerte Migrationspolitik
- Mehr Mitsprache von Entwicklungsländern in internationalen Finanz- und Wirtschaftsorganisationen
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
Weltweit gibt es eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sich die Einkommensungleichheiten in vielen der ärmsten Länder vor der Pandemie verringerte. Denn die Vermögen sind noch ungleicher verteilt. Extreme Armut und Ungleichheit fördert Migration: Aktuell gibt es so viele Flüchtlinge auf der Welt wie nie zuvor. Etwa jeder fünfte Mensch weltweit hat zudem bereits Diskriminierung erfahren.
Soziale, politische und wirtschaftliche Ungleichheit innerhalb von oder zwischen Ländern ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, da sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Seit 1980 hat weltweit das oberste ein Prozent der Bevölkerung mehr als doppelt so stark von der wirtschaftlichen Entwicklung profitiert als die ärmsten 50 Prozent. Damit verfestigen sich bzw. wachsen Ungleichheiten. Dies möchte die Weltgemeinschaft mit SDG 10 ändern.
So komplex das Thema „Ungleichheit“ ist, so vielfältig sind die Problemlagen. Im Sustainable Development Goals Report 2022 wird näher auf folgende Aspekte eingegangen:
Der Anteil der Bevölkerung, der weniger als die Hälfte des nationalen Durchschnittseinkommens verdient, ist ein wichtiger Gradmesser für Ausgrenzung und Armut. Vor der Corona-Pandemie ist dieser Anteil zurückgegangen und betrug im weltweiten Durchschnitt 13 Prozent. Zwischen 2013 und 2017 verringerte sich die Einkommensungleichheit zwischen den Ländern um 3,8 Prozent, für 2020 und 2021 wird dagegen ein Anstieg von 1,2 Prozent prognostiziert. Damit wären die Fortschritte der letzten beiden Jahrzehnte durch die Pandemie zunichte gemacht.
Die Beseitigung aller Formen von Diskriminierung ist ein weiteres zentrales Ziel bei SDG 10. Daten aus 49 Ländern zeigen jedoch, dass noch immer jeder fünfte Mensch Diskriminierung aus mindestens einem der nach den internationalen Menschenrechtsnormen verbotenen Gründe erfährt. Vor allem Frauen und Menschen mit Behinderungen sind von Diskriminierung betroffen und die Corona-Pandemie hat die strukturelle und systemische Diskriminierung verschärft. Hier braucht es eine gezielte Politik gegen Diskriminierung in jedem Land, um für mehr Gleichstellung zu sorgen.
Aktuell sind so viele Menschen auf der Flucht wie niemals zuvor, mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung. Mitte 2022 waren es laut des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR 103 Millionen Menschen, 13,6 Millionen Menschen mehr als noch Ende 2021. Vor allem der Krieg in der Ukraine, aber auch andere weltweite Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen sowie die Folgen des Klimawandels treiben die Flüchtlingszahlen in die Höhe. 5.895 Menschen starben 2021 auf der Flucht.

Wo steht Deutschland?
Auch in Deutschland werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Zwischen 1999 und 2005 ist die Ungleichheit der Einkommensverteilung angestiegen und verbleibt seither auf stabilem Niveau. Dieser Wert entspricht in etwa dem Wert der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Vermögen sind dagegen in Deutschland noch ungleicher verteilt als Einkommen. Auch in der Bildung existiert Chancenungleichheit zwischen deutschen und ausländischen Schülerinnen und Schüler.
In Deutschland wird Ungleichheit anhand des Anteils ausländischer Schulabsolvent:innen und des sogenannten „Gini-Koeffizienten“ gemessen, um Aussagen über (un-)gleiche Bildungschancen und Verteilungsgerechtigkeit zu treffen:
- Anteil ausländischer Schulabsolvent:innen: Grundbedingung für eine erfolgreiche Integration und gesellschaftliche Teilhabe ist eine qualitativ hochwertige Bildung. Daher möchte Deutschland den Anteil ausländischer Schulabsolvent:innen, die über mindestens einen Hauptschulabschluss verfügen, erhöhen und an die Quote deutscher Schulabsolvent:innen angleichen. Dies ist bisher nicht gelungen. Nachdem sich der Anteil bis 2013 bereits auf knapp 90 Prozent erhöht hatte, sank er bis 2019 wieder auf rund 82 Prozent gegenüber knapp 95 Prozent an deutschen Schulabsolvent:innen.
- „Gini-Koeffizient“: Dieser Koeffizient ist eine statistische Größe über die Ungleichverteilung von Einkommen mit Werten zwischen 0 und 1. Bei Wert „0“ hätte jede Person exakt das gleiche Einkommen, bei Wert „1“ würde eine Person über das gesamte Einkommen verfügen. Ziel ist es, dass der Gini-Koeffizient bis 2030 unter dem Wert der EU-27 liegt. Seit Jahren zeigt der Wert einen stabilen Verlauf und lag 2019 leicht unter dem Wert der EU-27. Damit wird dieser Indikator positiv bewertet (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).
Doch die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums aus dem Jahr 2020 macht deutlich, dass auch in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Bisher würden sich die Maßnahmen zur Verringerung von Ungleichheit jedoch darauf beschränken, den Ärmeren Einkommenzuwächse beispielsweise durch eine Anhebung des Mindestlohns zu ermöglichen. Doch Einkommen und Vermögen der Reichen blieben davon weitgehend unberührt. Um die Kluft allerdings nachhaltig zu verringern, sei eine Umverteilung von Vermögen beispielsweise durch eine Reform der Erbschaftssteuer oder die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer vonnöten. Mehr zum Thema Armut, Reichtum und Ungleichheit in Deutschland findet man im jährlichen Armuts- und Reichtumsbericht.
LpB-Angebote zu SDG 10

Was ist Rassismus?
Online-Dossier
Will man sich dem Begriff „Rassismus“ annähern, geht es zunächst um zwei Fragen: Was unterscheidet eigentlich die Konstrukte „Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit“ von Rassismus? Wie funktioniert die Spaltung zwischen „uns“ und „ihnen“? Ein Überblick.

Was ist Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit?
Online-Dossier
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, kurz GMF, ist ein sozialwissenschaftlicher Begriff, der abwertende und ablehnende Einstellungen gegenüber Personen oder Personengruppen zusammenfasst.

Antisemitismus
Online-Dossier
Antisemitismus ist die Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden. Antisemitismus bleibt ein gesellschaftliches Problem. Welche Formen des Antisemitismus gibt es? Welche Verschwörungstheorien mit antisemtischen Bezügen existieren? Diese Fragen und die Geschichte des Begriffs „Antisemitismus“ sind Themen dieses Dossiers.

Antiziganismus
Online-Dossier
Jahrzehnte hat es gedauert, bis der Völkermord an den Sinti und Roma anerkannt und in das öffentliche Gedenken einbezogen wurde. Auch der Antiziganismus ist noch immer existent. Unser Dossier gibt einen Überblick über die Geschichte der deutschen Sinti und Roma und informiert über Erscheinungsformen des Antiziganismus.

Flucht
Online-Dossier
Über 100 Millionen Menschen weltweit sind aktuell auf der Flucht, so viele wie nie zuvor. Aus welchen Ländern fliehen die meisten Menschen und warum? Und was passiert mit Geflüchteten, die nach Deutschland kommen? Ein Überblick.

Team meX
Fachbereich Extremismusprävention
Das Team meX möchte mit seiner Arbeit einen Betrag dazu leisten, junge Menschen frühzeitig über die Funktion und die Wirkung von Vorurteilen, Formen von Diskriminierung und extremistischen Ideologien aufzuklären.
#11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Ziel ist es, bis 2030 Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu gestalten. Gemeinsame politische Richtschnur für eine nachhaltige Stadtentwicklung in den nächsten zwei Jahrzehnten ist die „Neue Urbane Agenda“ von 2016.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Bezahlbarer Wohnraum und Grundversorgung für alle Menschen
- Sichere, bezahlbare und nachhaltige Mobilität in Städten und auf dem Land
- Inklusive und nachhaltige Stadtplanung und Flächennutzung
- Senkung der Umweltbelastung duch Städte inklusive besserer Luftqualität und Abfallbehandung
- Besserer Katastrophenschutz
- Besserer Schutz des Weltkultur- und Naturerbes
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
Heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. 2050 dürften es 70 Prozent sein. Städte sorgen für wirtschaftliches Wachstum, verursachen aber auch mehr als 70 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Die Herausforderungen sind vielfältig: die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, eine nachhaltige Flächennutzung und Mobilität, weniger Umweltbelastungen und ein geringeres Katastrophenrisiko. Dafür bedarf es einer nachhaltigen Stadtplanung.
Die Menschen weltweit zieht es immer mehr in die Städte. Schon heute lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, 2050 dürften es 70 Prozent sein. Angemessener Wohnraum für so viele Menschen ist knapp oder nicht vorhanden, weshalb mehr als eine Milliarde Menschen weltweit in städtischen Slums lebt, vor allem in Zentral- und Südasien, in Ost- und Südostasien und in Afrika südlich der Sahara. Eine effektive Stadtplanung muss hier für angemessenen und bezahlbaren Wohnraum sorgen, damit Menschen sich aus der Armut befreien können.
Über 6.000 Städte in 117 Ländern überwachen mittlerweile die Luftqualität ihrer Städte, eine Verdopplung gegenüber 2015. Denn Luftverunreinigungen sind schädlich für die Gesundheit. Dennoch leben 99 Prozent der städtischen Bevölkerung der Welt in Gebieten, in denen die Grenzwerte zur Luftreinhaltung nicht eingehalten werden. In Städten in Zentral- und Südasien ist die Feinstaubbelastung am höchsten. Ein weiteres Problem der Verstädterung stellt der zunehmende Müll dar. 2022 wurden weltweit durchschnittlich 82 Prozent der festen Siedlungsabfälle gesammelt und 55 Prozent in kontrollierten Einrichtungen behandelt. In vielen Ländern gibt es weiterhin offene Müllhalden oder die Abfälle werden einfach in der Umwelt entsorgt. Und von einer wirklich nachhaltigen Kreislaufwirtschaft mit hohen Recyclingquoten ist man noch Lichtjahre entfernt.
Schätzungen zufolge wird sich der jährliche Personenverkehr und die Zahl der Autos auf den Straßen zwischen 2015 und 2030 verdoppeln. Doch aktuell ist nur ein gutes Drittel der Städte mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen und nur gut die Hälfte der Stadtbevölkerung hat bequemen Zugang zu ihnen. Nachhaltige Mobilitäts- und Verkehrskonzepte sind jedoch zentral, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Städte als Lebens- und Wirtschaftsstandorte attraktiv zu machen (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?
Drei von vier Menschen in Deutschland leben in Städten. Laut einer aktuellen Studie fehlen 700.000 Wohnungen, besonders Sozialwohnungen und günstiger Wohnraum (Quelle: ZDF online). Neue, bezahlbare Wohnungen müssen also gebaut werden und nachhaltige Konzepte die Mobilitätswende voranbringen, auch um für mehr Luftqualität in den Städten zu sorgen und die Treibhausgasemissionen zu senken. Gleichzeitig möchte Deutschland die Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen für den Siedlungsbau und Verkehr begrenzen.
So vielfältig die Maßnahmen für die Schaffung nachhaltiger Städte und Gemeinden ist, so zahlreich sind die Indikatoren, anhand derer in Deutschland SDG 11 gemessen wird:
- Siedlungs- und Verkehrsfläche: Fläche ist eine begrenzte Ressource, um die viele konkurrieren. Bis 2030 soll die Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke auf durchschnittlich unter 30 Hektar pro Tag begrenzt werden. Bis 2050 sollen keine neuen Flächen mehr für diese Zwecke verwendet werden, sondern eine Flächenkreislaufwirtschaft existieren. Der Durchschnitt für neu in Anspruch genommene Fläche für Siedlungsbau und Verkehr ist seit drei Jahrzehnten kontinuierlich gesunken und lag 2018 bei 56 Hektar pro Tag. Bei Fortschreibung des Trends wird der Zielwert voraussichtlich erfüllt.
- Siedlungsdichte: Gleichzeitig möchte man die Siedlungsdichte erhöhen, also auf gleicher Fläche durch flächensparendes Bauen, Nachverdichtung und Nutzung von Leerstand mehr Menschen ansiedeln. Zwischen 2000 und 2009 nahm die Siedlungsdichte kontinuierlich ab. Seither zeigt sich ein uneinheitliches Bild in ländlichen und nicht ländlichen Regionen: Während die Siedlungsdichte in ländlichen Regionen weiter abnimmt, ist sie in den letzten Jahren in nicht ländlichen Regionen gestiegen.
- Endenergieverbrauch im Güter- und Personenverkehr: Der Verkehr in Städten macht Lärm, verschmutzt die Luft und belastet das Klima. Der Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen steht in engem Zusammenhang mit der im Verkehr verbrauchten Energie. Daher möchte Deutschland den Endenergieverbrauch im Güter- und Personenverkehr bis 2030 jeweils um 15 bis 20 Prozent senken. Bei beiden Indikatoren liegt Deutschland deutlich daneben. Beim Güterverkehr ist der Endenergieverbrauch zwischen 2005 und 2018 um über sechs Prozent gestiegen, vor allem aufgrund des gestiegenen Straßengüterverkehrs. Auch im Personenverkehr entwickelt sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung und stieg seit 2008 um rund ein Prozent. Die dringend notwendige Mobilitätswende lässt also noch auf sich warten. Wie diese aussehen könnte, findet sich unter anderem in der 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums.
- Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mobilität sorgt für mehr Teilhabe. Daher soll die Reisezeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu Mittel- und Oberzentren verringert werden. Dies gelang zwischen 2012 und 2018. Allerdings ist die Zeitersparnis von nicht einmal zwei Minuten marginal. Im Durchschnitt betrug die Reisezeit 2018 rund 22 Minuten.
- Überlastung durch Wohnkosten: Eine Überlastung durch Wohnkosten liegt vor, wenn man mehr als 40 Prozent des verfügbaren Einkommens fürs Wohnen ausgeben muss. Ziel der Bundesregierung ist es, den Anteil der Personen, bei denen diese Überlastung vorliegt, bis 2030 auf 13 Prozent zu senken. Dies ist erfüllt: 2021 waren es rund elf Prozent in Deutschland, bei den EU-27 lag der Anteil bei acht Prozent (Quelle: Statistisches Bundesamt). Allerdings macht der Indikatorenbericht deutlich, dass der Indikator nur eingeschränkte Aussagekraft besitzt. Denn unter den Armutsgefährdeten lag der Anteil der durch Wohnkosten überlasteten Personen im Jahr 2019 bei 48 Prozent (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021). Auf diese Problematik macht unter anderem auch die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums aufmerksam.
Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ modifiziert die Zielwerte einiger Indikatoren und nimmt die Indikatoren Feinstaubbelastung, Siedlungsabfall und Verkehrsverlagerung im Schienen- und Personenverkehr hinzu. Dadurch kommt das Modellprojekt auf einen Fortschritt bei der SDG-Zielerreichung von knapp 35 Prozent gegenüber dem offiziellen Monitoringfortschritt von knapp 21 Prozent, erzielt demnach sogar ein besseres Ergebnis.
LpB-Dossiers zu SDG 11

Smart City
Technologie in der nachhaltigen Stadtentwicklung
Ist die Smart City das Stadtkonzept der Zukunft – oder gehört für eine nachhaltige und langfristige Stadtentwicklung mehr dazu als der Einsatz von Technik?

Wohnen
Die neue soziale Frage?
Wohnen gehört zu den existenziellen Grundbedürfnissen des Menschen. Sorgenfreies Wohnen ist jedoch keine Selbstverständlichkeit mehr. Ist die Wohnungsnot die neue soziale Frage?
#12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion

Unsere Erde ist nur begrenzt belastbar und wir verbrauchen zu viele Ressourcen. So, wie die Menschen heute weltweit leben, bräuchten wir nicht nur eine Erde, sondern 1,75 Erden. Nehmen wir den Lebensstandard in Deutschland, sind es sogar fast drei Erden. Daher ist es das Ziel, bis 2030 auf nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion umzustellen.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen
- Abfallvermeidung und besseres Recycling
- Weniger Nahrungsmittelverschwendung
- Ermutigung von Unternehmen, nachhaltiger zu produzieren
- Bessere Information an Verbraucher:innen über nachhaltige Produkte und nachhaltigen Konsum
- Umstellung auf nachhaltige Beschaffung im öffentlichen Dienst
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
Nicht nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sind die Grundursache für die dreifache globale Krise des Klimawandels, des Biodiversitätsverlusts und der Umweltverschmutzung. Unsere Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen stieg in den letzten zwanzig Jahren um 65 Prozent. Gleichzeitig verschwenden wir zu viele Nahrungsmittel und produzieren zu viel Müll.
Die natürlichen Ressourcen auf unserer Erde sind begrenzt. So, wie wir heute leben, bräuchten wir nicht nur eine Erde, sondern 1,75 Erden. Wir verbrauchen, verschwenden und zerstören zu viele Ressourcen. So ist unsere Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen von 2000 bis 2019 um 65 Prozent gestiegen. Um hier gegenzusteuern, braucht es höhere Ressourceneffizienz, eine Kreislaufwirtschaft und insgesamt eine Dematerialisierung unserer Wirtschaft und unseres Konsums.
Gleichzeitig verschwenden wir zuviel: 2020 gingen rund 13 Prozent der Nahrungsmittel zwischen Ernte und Einzelhandel verloren. Weitere 17 Prozent wurden im Endverbrauch im Einzelhandel, in der Gastronomie und in Haushalten verschwendet. Und das bei immer größerer Nahrungsmittelunsicherheit! Zudem nimmt die Flut an Plastikabfällen immer weiter zu und giftiger Elektroschrott landet in der Umwelt. 2019 fielen weltweit pro Kopf mehr als sieben Kilogramm Elektroschrott an. Davon wurden nur 1,7 Kilogramm umweltgerecht entsorgt.
Erfreulich ist, dass der Anteil an erneuerbaren Energien in den Entwicklungsländern schneller wächst als die dortige Bevölkerung. Doch die am wenigsten entwickelten Ländern hinken hier weiterhin hinterher und es bedarf gezielter Maßnahmen, um den Abstand aufzuholen.
Um nachhaltig leben und konsumieren zu können, muss man informiert sein. Daher kommt der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) eine Schlüsselfunktion zu. 90 Prozent der Länder gaben an, sie hätten BNE zumindest teilweise in ihrer Bildungspolitik und ihren Bildungsplänen verankert. Doch eine bei Lehrkräften in der Grund- und Sekundarstufe durchgeführte weltweite Umfrage ergab, dass sich jede vierte Lehrkraft außerstande sieht, Themen aus diesen Bereichen zu unterrichten (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?
Der ökologische Fußabdruck in Deutschland ist nach wie vor viel zu groß. Wir verbrauchen zu viele globale Rohstoffe und Energie und stoßen zu viel CO2 aus. Mit dem Umweltmanagement EMAS sollen Unternehmen umweltfreundlicher produzieren und mehr Produkte sollen künftig staatliche Umweltzeichen tragen. Doch die Fortschritte verlaufen nur schleppend.
In Deutschland wird SDG 12 anhand der folgenden Indikatoren gemessen:
- Marktanteil von Produkten mit staatlichen Umweltzeichen: Ziel ist es, diesen Anteil bis 2030 auf 34 Prozent zu erhöhen. 2018 lag er allerdings gerade einmal bei knapp acht Prozent. Hält dieser Trend an, wird das Ziel erheblich verfehlt. Da Greenwashing, also eine Marketingstrategie, mit denen sich Unternehmen ökologischer darstellen wollen als sie es in Wirklichkeit sind, jedoch weit verbreitet ist, wäre eine Ausweitung der Produktpalette mit staatlichen Umweltzeichen hilfreich für nachhaltige Kaufentscheidungen.
- Globale Umweltinanspruchnahme durch den Konsum privater Haushalte: Wenn wir Produkte kaufen und konsumieren, verbrauchen wir Rohstoffe und Energie und setzen CO2-Emissionen frei. Ziel ist es, alle drei Bereiche kontinuierlich zu reduzieren. Beim Rohstoffeinsatz und Energieverbrauch ist dies der Fall. Der Rohstoffeinsatz sank zwischen 2010 und 2016 leicht um drei Prozent, der Energieverbrauch um sechs Prozent. Die CO2-Emissionen sind jedoch nach einem Rückgang in den ersten Jahren wieder angestiegen, so dass es zwischen 2010 und 2016 keinen Unterschied gibt. Hier muss also dringend etwas getan werden.
- Umweltmanagement EMAS: Das Umweltmanagementsystem EMAS bietet ein Konzept für einen systematischen betrieblichen Umweltschutz. Ziel ist es, dass bis 2030 5.000 Unternehmen und Organisationen EMAS-zertifiziert sind. Im Jahr 2019 waren in Deutschland knapp 2.200 EMAS-Standorte registriert. Dies entspricht einer Erhöhung um elf Prozent gegenüber 2005. Dies reicht aber für die Zielerreichung nicht aus.
Vom zivilgesellschaftlichen SGD-Monitoring „2030 Watch“ erhält die Bundesregierung bei der Zielerreichung schlechte Noten: Im offiziellen Monitoring liege der Fortschritt gerade mal bei elf Prozent. Außerdem nimmt „2030 Watch“ die Indikatoren Verpackungsmüll, Verbrauch von Wasser in Flaschen und den ökologischen Fußabdruck in ihr Indikatorenset auf. Auch die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums macht auf den viel zu großen ökologischen Fußabdruck Deutschlands aufmerksam: Nachhaltig wäre ein Fußabdruck von 1,6 globalen Hektar (gha), weltweit beträgt der Fußabdruck 2,8 gha, Deutschland hat einen Fußabdruck von 4,7 gha.
LpB-Angebote zu SDG 12

Plastikmüll
Online-Dossier
Die Flut an Plastikabfällen gehört zu den größten Umweltproblemen des 21. Jahrhunderts. Wir müssen überdenken, wie wir Kunststoffe herstellen, verwenden und wiederverwerten.

Greenwashing
Online-Dossier
Hinter „Greenwashing“ verbirgt sich eine Marketingstrategie, mit denen sich Unternehmen ökologischer darstellen möchten als sie es in Wirklichkeit sind. Mehr zu den Tricks der Unternehmen in unserem Dossier.

Ethisch leben
E-Learning-Kurs
Im E-Learning-Kurs „Ethisch leben“ beschäftigen wir uns mit unseren Werten, wie wir diese mit unserem Alltagsverhalten in Einklang bringen können und was die Politik tun muss, damit wir nachhaltiger leben können.
#13 Maßnahmen zum Klimaschutz

Der Klimawandel stellt eine der größten Bedrohungen für unseren Planeten dar. Daher will die Weltgemeinschaft mit SDG 13 umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Was die internationale Staatengemeinschaft im Pariser Klimaabkommen von 2015 beschlossen hat, ist für SDG 13 zentral.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius; bis 2050 globale Treibhausgasneutralität
- Unterstützung von 50 Schwellen- und Entwicklungsländern bis 2025 bei der Umsetzung ihrer Klimaziele
- Absicherung gegen Klimarisiken von 500 Millionen Menschen, die besonders verwundbar sind, bis 2025
- Internationale Finanzinstitutionen für Klimaziele fit machen
- Mobilisierung des Privatsektors und des privaten Engagements für Klimaschutz
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
Bereits heute ist es weltweit durchschnittlich 1,1 Grad wärmer als zu vorindustriellen Zeiten. Wird die Erderwärmung nicht begrenzt, könnten die Temperaturen bis 2100 um drei Grad ansteigen, mit verheerenden Folgen für unseren Planeten. Doch die bisherigen Anstrengungen reichen nicht aus und das Zeitfenster schließt sich, um eine Klimakatastrophe abzuwenden. 2021 und 2022 wurden neue Höchststände bei den CO2-Emissionen erreicht.
Nachdem die Treibhausgasemissionen im Corona-Jahr 2020 zurückgegangen waren, stiegen sie 2021 um sechs Prozent und erreichten einen neuen Höchststand. 2022 war der Anstieg mit 0,9 Prozent auf insgesamt 36,8 Milliarden Tonnen energiebedingte CO2-Äquivalente zwar nicht so stark wie befürchtet. Doch die Emissionen verharren auf einem Rekordniveau (Quelle: Internationale Energieagentur).
Wird hier nicht schnell und umfassend gehandelt, könnten die Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts auf rund drei Grad ansteigen. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen die globalen Treibhausgasemissionen bis 2030 um 43 Prozent und bis 2050 auf Null sinken. Doch die aktuellen nationalen Klimaziele der Länder reichen nicht aus und man rechnet vielmehr mit einem weiteren Anstieg der Emissionen. Der Weltklimarat IPCC ruft daher Alarmstufe Rot für die Menschheit aus.
Schon der aktuelle Temperaturanstieg von rund 1,1 Grad hat fatale Auswirkungen auf unsere Ökosysteme und die Menschen: Der Meeresspiegel wird bis 2100 um 30 bis 60 Zentimeter steigen. Der Biodiversitätsverlust schreitet immer schneller voran, unzählige Tier- und Pflanzenarten sterben aus. Dürren werden voraussichtlich 700 Millionen Menschen bis 2030 vertreiben und es wird bis 2030 rund 40 Prozent mehr Katastrophen wie Starkregen, Überschwemmungen, Stürme oder Hitzeperioden mit Dürren als noch 2015 geben (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).
Der Klimawandel trifft die ärmsten Länder am härtesten. Zugleich tragen diese Länder so gut wie nichts zum Klimawandel bei und fordern daher Unterstützung von den Industrienationen im Kampf gegen und die Anpassungen an die Auswirkungen des Klimawandels. Doch die jährlich zugesagte kollektive Klimafinanzierung in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar von reicheren an ärmere Länder wurde erneut verfehlt. 2020 lag die Summe bei rund 83 Milliarden US-Dollar (Quelle: Auswärtiges Amt).

Wo steht Deutschland?
Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes hat Deutschland beschlossen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Bis zum Jahr 2045 soll Treibhausgasneutralität erreicht werden (Quelle: Bundesregierung). Für 2022 hat Deutschland das Klimaziel geschafft.
Zentraler Indikator für SDG 13 ist die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Für das Jahr 2022 hat Deutschland sein Klimaziel erreicht: Der Ausstoß ging im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent auf 746 Millionen Tonnen zurück. Zu verdanken ist das vor allem einem Rückgang bei der Industrie – Sektoren wie Verkehr und Energie emittierten dagegen mehr.
Im Energiesektor ging der Gasverbrauch zurück, doch es wurde mehr Kohle verbrannt. Insgesamt konnte der Sektor sein Klimaziel jedoch einhalten. Anders sieht es beim Verkehr und im Gebäudebereich aus. Der Verkehrssektor emittierte mehr und erreichte auch sein Klimaziel nicht. Der Gebäudebereich konnte dagegen Treibhausgase einsparen, jedoch nicht ausreichend und verfehlte daher sein Klimaziel. Großer Gewinner ist die Industrie: Hier wurden 2022 über zehn Prozent eingespart. Auch Land- und Abfallwirtschaft stießen weniger Treibhausgase aus und erreichten ihre Ziele.
Die Erneuerbaren Energien decken mit über 20 Prozent erstmals rund ein Fünftel des gesamten Bruttoendenergieverbrauchs. Der Bruttoendenergieverbrauch bezeichnet den Verbrauch an Strom, Wärme und Kraftstoffen. Beim Bruttostromverbrauch, der sich nur auf den Stromsektor bezieht, betrug der Anteil der Erneuerbaren rund 46 Prozent. Dennoch ist das Wachstum zu langsam, um das Ziel – 80 Prozent Anteil am Bruttostromverbrauch aus Erneuerbaren bis 2030 – zu erreichen (Quelle: Umweltbundesamt).
Bei der Klimafinanzierung hat Deutschland sein Ziel, bis 2020 jährlich vier Milliarden Euro zur kollektiven Klimafinanzierung beizutragen, bereits 2019 erreicht. 2021 waren es 5,34 Milliarden Euro für Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen. Bis 2025 soll sich der deutsche Anteil an der globalen Klimafinanzierung auf jährlich sechs Milliarden Euro steigern (Quelle: BMZ).
Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ nimmt weitere Indikatoren aus dem Klimaschutz-Index hinzu: Klimapolitik, Energieverbrauch und erneuerbare Energien. Dadurch schmälert sich der Fortschritt um zehn Prozent (offizielles Monitoring: 73 Prozent, zivilgesellschaftliches Monitoring: 63 Prozent).
LpB-Dossiers zu SDG 13

Klimawandel
Ist das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen?
Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen für unseren Planeten. Aber was ist der Klimawandel genau? Und wo stehen wir im Kampf gegen die globale Erwärmung? Ist das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen? Das Dossier klärt Grundsatzfragen zum Klimawandel.

Klimaflucht
Migration in Zeiten des Klimawandels
Immer mehr Menschen sind gezwungen, ihre Heimat wegen der Auswirkungen des Klimawandels zu verlassen. Doch was versteht man unter Umweltflüchtlingen? Wie viele sind es, woher kommen und wohin gehen sie? Genießen sie einen besonderen Schutz? Unser Dossier gibt Antworten.

Klimaschutz in Deutschland
Bis 2045 klimaneutral – ist das zu schaffen?
Um seinen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten, hat Deutschland es sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein. Wo steht Deutschland derzeit in puncto Klimaschutz? Ein Dossier.
#14 Leben unter Wasser

Die Ozeane sind Grundlage unseres Lebens. Doch steigende Wassertemperaturen, Überfischung und Verschmutzung machen den Meeren zu schaffen. Daher ist es Ziel, diese Entwicklung zu stoppen und unsere Ozeane künftig nachhaltiger zu nutzen.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Deutliche Verringerung der Meeresverschmutzung, Versauerung und Vermüllung durch Plastik
- Wiederherstellung und Schutz gesunder und artenreicher Meeres- und Küstenökosysteme
- Ausweisung von mindestens zehn Prozent der Meere als Meeresschutzgebiete
- Nachhaltige Fischerei; keine Überfischung mehr; keine Subventionen mehr für problematische Fischereipraktiken
- Mehr Forschung und Technologietransfer
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
Über 70 Prozent der Erdoberfläche ist von Meeren bedeckt. Doch steigende Wassertemperaturen, Versauerung und Vermüllung vor allem durch Plastik bedrohen das größte Ökosystem unseres Planeten. Der Fischfang ist für Millionen Menschen in Entwicklungsländern Nahrungsmittel und Einkommensquelle. Doch Überfischung lässt die Fischbestände schrumpfen.
Die Problemlagen in unseren Ozeanen sind vielschichtig:
- Versauerung: Ozeane absorbieren etwa ein Viertel aller jährlichen CO2-Emissionen und schwächen so den Klimawandel ab. Doch dadurch erhöht sich der Säuregehalt in den Ozeanen, was zulasten der im Meer lebenden Organismen, Tiere und Pflanzen geht. Zwischen 2009 und 2018 gingen bereits 14 Prozent der Korallenriffe und damit zahlreiche Tier- und Pflanzenarten verloren.
- Vermüllung durch Plastik: 2021 gelangten laut einer Studie 17 Millionen Tonnen Plastikmüll in unsere Meere. Plastik macht damit 85 Prozent des Meeresmülls aus und bedroht alles Leben im Meer. Bis 2050 könnte es mehr Plastik als Fische in den Ozeanen geben.
- Meeresschutzgebiete: Nach 15 Jahren Verhandlung haben sich die UN-Mitgliedstaaten Anfang März 2023 auf das erste internationale Hochsee-Abkommen zum Schutz der Weltmeere geeinigt. Es sieht vor, künftig mindestens 30 Prozent der Weltmeere als Schutzgebiete auszuweisen, ein Meilenstein beim Schutz der Meere.
- Überfischung: Die weltweiten Fischbestände sind durch Überfischung und illegalen Fischfang bedroht. 2019 waren mehr als ein Drittel der weltweiten Bestände überfischt. Hier braucht es bessere Vorschriften und Überwachung, um eine nachhaltige Fischerei in allen Ländern durchzusetzen.
- Kleinfischerei: Nach Schätzungen der Vereinten Nationen steht der Lebensunterhalt von mehr als drei Milliarden Menschen in (direktem) Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt der Meere und der Küstengebiete. Fast eine halbe Milliarde Menschen sind zumindest teilweise von der Kleinfischerei abhängig, auf die weltweit 90 Prozent der Arbeitsplätze in der Fischerei entfallen, die meisten davon in den am wenigsten entwickelten Ländern. Doch durch Verschmutzung und Überfischung ist die Existenzgrundlage vieler Kleinfischer bedroht. Seit 2015 gibt es daher in vielen Ländern vermehrte Anstrengungen, die Kleinfischerei zu unterstützen (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).
Die Fortschrittsanalyse der 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums fällt gemischt aus: Während es vergleichsweise große Fortschritte beim Ausweisen von Meeresschutzgebieten gibt, kommt man im Kampf gegen die Überfischung und bei der Wiederherstellung und dem Schutz von Meeresökosystemen nicht weiter. Schädliche Fischereisubventionen konnten zumindest graduell abgeschafft werden. Doch nach wie vor nehmen die weltweiten Fischbestände konstant ab.

Wo steht Deutschland?
In Deutschland wird noch immer zu wenig getan, um Nord- und Ostsee vor Verschmutzung und Überfischung zu schützen. Die Stickstoffeinträge sind nach wie vor zu hoch und der Anteil der nachhaltig bewirtschafteten Fischbestände liegt bei etwas mehr als der Hälfte, sollte jedoch bereits 2020 bei 100 Prozent liegen.
In Deutschland wird SDG 14 anhand der folgender Indikatoren gemessen:
- Stickstoffeintrag in die Nord- und Ostsee: Hohe Konzentrationen von Stickstoff in den Meeren können zu Sauerstoffmangel und dadurch zu Artensterben führen. Daher will Deutschland die Stickstoffzufuhr begrenzen auf 2,8 mg Stickstoff pro Liter Abfluss in die Nordsee und 2,6 mg Stickstoff pro Liter Abfluss in die Ostsee. Auch wenn die Konzentrationen in den letzten Jahren zurückgingen, verharren sie seit 2016 auf einem konstanten Niveau zwischen 3,0 und 3,2 mg. Einzelne Flüsse liegen sogar noch um ein Vielfaches über dem Zielwert.
- Anteil der nachhaltig befischten Fischbestände in Nord- und Ostsee: Eigentlich sollten bereits bis 2020 alle wirtschaftlich genutzten Fischbestände nachhaltig bewirtschaftet sein. Das bedeutet, dass nicht mehr Fisch gefangen wird als sich die Fischpopulationen eigenständig erholen können. Doch bisher ist das nur bei etwas über der Hälfte der Fall (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).
Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ sieht einen Fortschritt von etwa 50 Prozent bei SDG 14, nimmt allerdings noch die beiden Indikatoren des Ocean Health Index „Food Provision“ und „Clean Waters“ hinzu.
LpB-Dossiers zu SDG 14

Weltwassertag: Unser Wasser
Wird das Wasser knapp?
Wasser ist für viele ein selbstverständliches Gut. Aber wie lange noch? Denn die Wasserknappheit in anderen Ländern und hierzulande nimmt zu. Wie ist die Situation weltweit und in Deutschland? Unser Dossier klärt auf.

Plastikmüll
Was tun gegen die Plastikflut?
Die Flut an Plastikabfällen gehört zu den größten Umweltproblemen des 21. Jahrhunderts. Wir müssen überdenken, wie wir Kunststoffe herstellen, verwenden und wiederverwerten.
#15 Leben an Land

Intakte Wälder, Böden, Berge, Moore, Seen und Flüsse sind Lebensraum für Mensch und Tier, liefern Nahrungsmittel und Rohstoffe, binden Treibhausgase und sind widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels. Ziel ist es daher, bis 2030 Landökosysteme zu schützen, wiederherzustellen und ihre nachhaltige Nutzung zu fördern. Dazu gehört unter anderem, unsere Wälder zu schützen und den Verlust der biologischen Vielfalt zu beenden.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Intakte Landökosysteme schützen und geschädigte Landökosysteme wiederherstellen
- Verlust der biologischen Vielfalt verringern
- Gute Umweltgesetzgebung durchsetzen
- Entwaldung beenden und Wälder nachhaltig bewirtschaften
- Wüstenbildung bekämpfen
- Invasion fremder Arten verhindern
- Wilderei beenden
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
Die Zerstörung von Landökosystemen und der Biodiversitätsverlust gehen unaufhaltsam weiter. Jährlich werden rund zehn Millionen Hektar Wald zerstört, 90 Prozent davon für Agrarflächen. Etwa 40.000 Arten sind in den nächsten Jahrzehnten vom Aussterben bedroht. Immerhin steht mittlerweile knapp die Hälfte der für Biodiversität besonders wichtigen Süßwasser-, Land- und Berggebiete unter Naturschutz.
Wälder sind Rohstofflieferant, Orte der Erholung und essentiell im Kampf gegen den Klimawandel. Doch die Waldflächen der Erde schrumpfen weiter, allerdings nicht mehr ganz so schnell wie früher. Zwischen 2000 und 2020 sank der Anteil der Wälder an der gesamten Landfläche von 31,9 auf 31,2 Prozent und damit netto um fast 100 Millionen Hektar. Allerdings verläuft die Entwicklung der Waldflächen weltweit unterschiedlich. Während es in Europa, Asien und Nordamerika mittlerweile wieder mehr Wälder gibt, gehen in Lateinamerika und Afrika südlich der Sahara Waldflächen verloren. Sie müssen meist Agrarflächen weichen. Die Abholzung des Regenwalds ist im Kampf gegen den Klimawandel und für die Biodiversität besonders gefährlich.
Das Risiko des Artensterbens steigt weiter: Rund 40.000 Arten sind in den nächsten Jahrzehnten vom Aussterben bedroht. Der Rote-Liste-Index, der das Aussterberisiko misst, verschlechterte sich in den letzten beiden Jahrzehnten um rund neun Prozent. Vor allem in Asien und den kleinen Inselentwicklungsländern ist das Artensterben aufgrund von nicht nachhaltiger Landwirtschaft und Abholzung am höchsten. Dass Biodiversität zentral für alle Nachhaltigkeitsziele und damit unseren Planeten ist, findet zwar immer mehr Eingang in nationalen Planungsprozessen, jedoch viel zu langsam.
Immerhin steht mittlerweile knapp die Hälfte der für Biodiversität besonders wichtigen Süßwasser-, Land- und Berggebiete unter Naturschutz. Vier Regionen – Westasien und Nordafrika, Zentral- und Südasien, Ost- und Südostasien und Ozeanien – tun in puncto Ausweisung von Schutzgebieten jedoch nach wie vor zu wenig.
Bei der Umsetzung von Rahmenplänen für die nachhaltige Nutzung genetischer Ressourcen kommt die Weltgemeinschaft weiter voran. Mittlerweile haben 132 Länder und die Europäische Union das Nagoya-Protokoll zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt ratifiziert. Ziel des Protokolls ist es, einen Interessenausgleich zwischen den Ursprungsländern genetischer Ressourcen und den Ländern, die diese Ressourcen nutzen, zu schaffen. Auch die Zahl derjenigen Länder, die den Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft unterzeichnet haben, ist auf 148 gestiegen (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?
Die Folgen des Klimawandels machen auch den Wäldern in Deutschland zu schaffen: Vier von fünf Bäumen sind krank, so der Waldzustandsbericht 2022. Beim Schutz der Artenvielfalt tritt man auf der Stelle. Das zeigt der Bestand repräsentativer Vogelarten, der sich seit Jahren nicht verbessert hat. Und auch die Stickstoffeinträge in empfindliche Ökosysteme wie Wälder, Moore oder Heiden sind immer noch zu hoch.
In Deutschland wird die Artenvielfalt anhand respräsentativer Vogelarten gemessen. Weitere Indikatoren für SDG 15 sind die Stickstoffeinträge in empfindliche Ökosysteme sowie Zahlungen für den internationalen Wiederaufbau von Wäldern und den weltweiten Bodenschutz.
- Artenvielfalt: Der für Artenvielfalt herangezogene Indikator zeigt die Bestandsentwicklung für 51 ausgewählte Vogelarten in Form eines Index. Ziel ist es, einen Indexwert von 100 bis 2030 zu erreichen. Ursprünglich wollte man das bereits 2015 geschafft haben. Gemessen wird die Entwicklung des Bestandes in unterschiedlichen Landschaften wie Wäldern, Siedlungen oder Küsten. Zwischen 2006 und 2016 stagnierte der Wert bei 70. Bei gleichbleibender Entwicklung wird das Ziel also nicht erreicht.
- Stickstoffeinträge: Schädliche Stickstoffe können über Gase, Regen und Feinstaub in Ökosysteme eingetragen werden. Sie haben negativen Einfluss auf empfindliche Ökosysteme wie Wälder, Moore oder Heiden. Arten werden verdrängt oder sterben aus und Pflanzen werden anfälliger gegenüber Frost, Dürre oder Schädlinge. Ziel ist es daher, bis 2030 den Flächenanteil mit erhöhtem Stickstoffeintrag um 35 Prozent gegenüber 2005 zu reduzieren. Seit 2011 stagnieren jedoch die Werte. Im Jahr 2015 wurden in Deutschland auf 68 Prozent der Flächen die Belastungsgrenzen überschritten. Besonders hoch sind die Überschreitungen in Teilen Norddeutschlands aufgrund großer landwirtschaftlicher Flächen.
- Wiederaufbau von Wäldern unter REDD+ und internationaler Bodenschutz: REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) ist ein internationales Konzept, das Entwicklungsländer finanziell dafür belohnt, dass sie die Entwaldung und damit Emissionen nachweislich reduzieren. Auch am internationalen Bodenschutz zum Beispiel bei der Bekämpfung von Wüstenbildung beteiligt sich Deutschland. In beiden Fällen sollen die finanziellen Beiträge bis 2030 steigen, was seit 2009 fast kontinuierlich der Fall ist. 2019 lag der Anteil der deutschen REDD+-Finanzierung bei rund 64 Millionen Euro und 746 Millionen Euro beim internationalen Bodenschutz (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).
Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ erweitert das Indikatorenset um die Indikatoren Anteil FSC-zertifizierter Wälder und einen Indikator, der die negativen Auswirkungen unserer Nahrungsmittelimporte auf die Biodiversität misst. Die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums macht unter anderem auf die globale Waldzerstörung, vor allem von Regenwald, aufgrund der Soja-, Rindfleisch- und Palmölproduktion aufmerksam. Was wir essen hat also unmittelbare Auswirkungen auf Ökosysteme und die Biodiversität.
LpB-Angebote zu SDG 15
Tag des Waldes: Unser Wald
Online-Dossier
Wälder bedecken weltweit ein Drittel der Landmasse. Doch die weltweite Entwaldung setzt sich mit alarmierender Geschwindigkeit fort. Die Vereinten Nationen haben daher den 21. März als Internationalen Tag der Wälder ausgerufen.

Weltumwelttag: Unsere Umwelt
Online-Dossiers
Die Vereinten Nationen riefen den Weltumwelttag 1974 ins Leben, um das weltweite Bewusstsein und Handeln zum Schutz unserer Umwelt zu fördern. Teilnehmende des Freiwilligen Ökologischen Jahres zeigen, wie sie sich täglich für den Umweltschutz einsetzen.

Biologische Vielfalt
E-Learning-Kurs
Biologische Vielfalt ist die Grundlage für menschliches Leben – doch sie ist vorrangig durch uns Menschen bedroht. Wie kann unser Beitrag zur Erhaltung und zum Schutz des natürlichen Lebensraums aussehen? Unter anderem um diese Frage geht es in diesem Kurs.
#16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Ziel ist es, bis 2030 friedliche und inklusive Gesellschaften zu schaffen, allen Menschen Zugang zur Justiz zu ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Verringerung aller Formen von Gewalt weltweit
- Beendigung von Missbrauch und Ausbeutung von Kindern
- Förderung der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene inklusive gleichberechtigtem Zugang zur Justiz
- Verringerung illegaler Finanz- und Waffenströme und Bekämpfung der organisierten Kriminalität
- Bekämpfung von Korruption und Bestechung
- Öffentlicher Zugang zu Informationen für alle und Schutz der Grundfreiheiten
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
Derzeit wüten so viele Gewaltkonflikte auf der Welt wie zuletzt 1946. Über 100 Millionen Menschen sind auf der Flucht, unter anderem wegen Kriegen und gewalttätigen Konflikten. Immerhin sank die weltweite Tötungsrate in den letzten Jahren um rund fünf Prozent. Korruption und organisierte Kriminalität sind in vielen Ländern allgegenwärtig.
Frieden ist einer der fünf Grundpfeiler der Agenda 2030. Doch Ende 2020 lebte ein Viertel der Weltbevölkerung in von Konflikten betroffenen Ländern und immer neue kommen hinzu, etwa der Krieg in der Ukraine oder der gewälttätige Konflikt im Sudan. So hat sich laut des Global Peace Index 2022 des Institute for Economics and Peace (IEP) der Status des Weltfriedens gegenüber dem Vorjahr um rund 0,03 Prozent verschlechtert. Auch die Rüstungsausgaben sind 2022 laut des Friedensforschungsinstituts SIPRI mit 2.040 Milliarden Euro auf ein Rekordhoch gestiegen.
Am härtesten treffen Konflikte die Zivilbevölkerung, vor allem Frauen und Kinder. Rund 103 Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht, so viele wie niemals zuvor (Quelle: UNHCR). Viele fliehen vor Kriegen und Gewalt oder werden gewaltsam vertrieben. 41 Prozent der weltweit Vertriebenen sind Kinder, die aufgrund ihrer teils traumatischen Erfahrungen immensen Schaden erleiden. Auf internationaler Ebene, vor allem über die Vereinten Nationen, sucht man nach diplomatischen Lösungen und schickt humanitäre Hilfe in die Konfliktregionen. In den letzten zehn Jahren hat die Welt 349 Milliarden US-Dollar für Friedenssicherung, humanitäre Hilfe und Flüchtlingshilfe ausgegeben.
Ohne ein sicheres Umfeld und rechtstaatlich handelnde Institutionen ist eine nachhaltige Entwicklung unmöglich. In diesem Zusammenhang sind sowohl die internationale Zusammenarbeit gegen illegale Waffenströme als auch die Bekämpfung der Korruption zentral. Doch die systematische Rückverfolgung von Waffen bleibt weltweit schwierig und die Kooperationen müssen ausgebaut werden. Korruption gibt es in allen Regionen der Welt. Am verbreitesten ist sie in Ost- und Südostasien und den am wenigsten entwickelten Ländern. Weltweit wird fast jedes sechste Unternehmen von öffentlichen Bediensteten zur Zahlung von Bestechungsgeldern aufgefordert. Hier braucht es transparente Geschäftsprozesse und eine konsequente Strafverfolgung, um Korruption einzudämmen.
Positiv entwickelt hat sich die weltweite Tötungsrate: Sie ging von 2015 bis 2020 um rund fünf Prozent zurück. Schätzungen zufolge dürfte sie sich bis 2030 um 19 Prozent reduzieren, womit das Ziel jedoch verfehlt wird. Bei der Tötungsrate gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede: Während die Tötungsrate von Männern weltweit zurückging, sank die Tötungsrate von Frauen nicht so stark oder ist teilweise sogar wieder gestiegen (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?
Deutschland ist im Vergleich zu vielen anderen Regionen der Welt ein sicheres Land: Die Anzahl der Straftaten geht seit Jahren fast kontinuierlich zurück. Auch in puncto Korruption gehört Deutschland nach dem Corruption Perceptions Index zu den am wenigsten korrupten Ländern. Allerdings hat man sich diesbezüglich höhere Ziele gesteckt, die bisher nicht erreicht wurden.
In Deutschland wird SDG 16 anhand dreier Indikatoren gemessen:
- Straftaten: Ein sicheres Umfeld ist für die persönliche Entfaltung und nachhaltige Entwicklung zentral. Daher will Deutschland die Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner:innen bis 2030 auf unter 6.500 senken. Dieses Ziel ist beinahe erreicht. In den letzten Jahren sank die Zahl der Straftaten fast kontinuierlich und betrug 6.548 im Jahr 2019.
- Waffenvernichtung: Um illegale Waffenströme auszutrocknen, braucht es eine weltweite Zusammenarbeit. Daher ist es das Ziel, dass Deutschland jährlich mindestens 15 Projekte zur Sicherung, Registrierung und Zerstörung von Kleinwaffen und leichten Waffen durchführt. Seit 2015 hat Deutschland diese Zielmarke jährlich übertroffen. 2019 gab es 31 solcher Projekte.
- Korruption: Die Nichtregierungsorganisation Transparency International erhebt jährlich den „Index der Korruptionswahrnehmung (Corruption Perceptions Index)“. Auf einer Skala von 0 (hohes Maß an wahrgenommener Korruption) bis 100 (keine wahrgenommene Korruption) des CPI erreicht Deutschland 79 Punkte und hat sich damit leicht verschlechtert. Mit einem weltweiten neunten Platz gehört Deutschland aber nach wie vor zu den Ländern mit der geringsten Korruption. Auf den ersten drei Plätzen liegen Dänemark, Neuseeland und Norwegen, auf den letzten drei Plätzen der Süd-Sudan, Syrien und Somalia. Deutschland strebt eine deutliche Verbesserung an, doch der CPI bleibt seit zehn Jahren konstant (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).
Nimmt man nur die vier offiziellen Indikatoren der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, dann kommt das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ bereits auf eine Übererfüllung der Zielsetzung. „2030 Watch“ nimmt jedoch drei weitere Indikatoren hinzu, um den Blick um illegale Finanzströme, Waffenexporte und das Recht auf Information zu erweitern. Dann liegt der Fortschritt bei rund 83 Prozent. Auch die 5-Jahres-Zwischenbilanz des Global Policy Forums aus dem Jahr 2020 hebt illegale Finanzströme und Steuervermeidungspraktiken als Problem einer nachhaltigen Entwicklung hervor. So gehen nach Schätzungen jährlich rund 500 Milliarden US-Dollar an Steuergeldern allein durch Steuertricks internationaler Konzerne verloren.
LpB-Angebote zu SDG 16

Demokratie und Frieden
Online-Dossier
Demokratie und Frieden – zwei Begriffe, die sich nicht leicht fassen lassen, unterschiedliches meinen und doch häufig miteinander in Verbindung stehen. Gehören Demokratie und Frieden zwingend zusammen? Eine Annäherung.

Flucht
Online-Dossier
Über 100 Millionen Menschen weltweit sind aktuell auf der Flucht, so viele wie nie zuvor. Aus welchen Ländern fliehen die meisten Menschen und warum? Und was passiert mit Geflüchteten, die nach Deutschland kommen? Ein Überblick.

Servicestelle Friedensbildung
Angebote zur Friedensbildung
Die Servicestelle ist Beratungs-, Vernetzungs- und Kontaktstelle für alle Schulen des Landes sowie weitere Akteur:innen aus dem Bereich der Friedensbildung. Ihre Aufgabe ist es, Friedensbildung fächerübergreifend in den Schulen des Landes zu stärken.
#17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

Die 17 Nachhaltigkeitsziele können nur durch eine starke, globale Partnerschaft erreicht werden. Denn globale Herausforderungen erfordern globale, gemeinsame Anstrengungen. Daher müssen Regierungen, zivilgesellschaftliche Akteure, Unternehmen und jede:r Einzelne auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene an der Umsetzung der Ziele arbeiten. Das Leitprinzip „Niemanden zurücklassen“ spielt hierbei eine zentrale Rolle.
Was soll bis 2030 erreicht werden?
- Stärkung der finanziellen Situation der Entwicklungsländer
- Mehr Technologie- und Wissenstransfer
- Öffnung der Märkte zur Verbesserung der Handelschancen der Entwicklungsländer
- Bereitstellung von 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens durch reichere Länder an ärmere Länder
- Multi-Akteurs-Ansatz auf allen Ebenen
Quellen: BMZ, Bundesregierung

Wo stehen wir in der Welt?
In 2021 flossen so viele Entwicklungsausgaben an Länder des globalen Südens wie noch nie, was vor allem an den Corona-Hilfen lag. Auch die ausländischen Direktinvestitionen und Rücküberweisungen nahmen zu. Gleichzeitig kämpfen die weniger entwickelten Länder mit Rekordinflation, steigenden Zinssätzen und einer enormen Schuldenlast. Dies hemmt den Wiederaufschwung nach der Corona-Pandemie.
Um eine nachhaltige Entwicklung für alle Länder und Menschen zu erreichen, hat sich die Weltgemeinschaft darauf verständigt, dass reichere Nationen einen Teil ihres Bruttonationaleinkommens (BNE) an ärmere Länder abgeben. Diese öffentlichen Entwicklungsleistungen nennt man „Official Development Assistance“ (ODA). In 2021 sind die Netto-ODA auf einen Rekordwert von 178 Milliarden US-Dollar gestiegen, vor allem dank der Corona-Hilfen. Doch die Höhe der ODA zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele ging 2020 um mehr als 18 Prozent zurück. Insgesamt gaben die 30 Geberländer und die Europäische Union 0,33 Prozent ihres BNE in 2020 für Entwicklungsleistungen aus, ein neuer Höchstwert, der jedoch immer noch weit hinter dem Ziel von 0,7 Prozent zurückbleibt.
Aktuell kämpfen viele Länder des globalen Südens mit einer Rekordinflation, steigenden Zinssätzen und einer enormen Schuldenlast. Die gesamte Auslandsverschuldung der Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen stieg 2020 um rund fünf Prozent auf 8,7 Billionen US-Dollar. In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara verdreifachte sich das Verhältnis von Schuldendienst zu Exporten sogar.
Positiv entwickelten sich dagegen die ausländischen Direktinvestitionen und die Rücküberweisungen: So stiegen erstere um 64 Prozent in 2021 gegenüber 2020. Allerdings verzeichneten die entwickelten Länder den stärksten Anstieg an Direktinvestitionen, während das Wachstum in den weniger entwickelten Ländern eher verhalten ausfiel. Die wirtschaftliche Erholung nach dem ersten durch die Pandemie verursachten Schock kommt also eher entwickelten als weniger entwickelten Ländern zugute. Viele Migrantinnen und Migranten schicken Gelder in ihre Herkunftsländer, um ihre Familien zu unterstützen. So blieben die Überweisungsströme von reicheren in ärmere Länder mit einem Zuwachs von knapp neun Prozent in 2021 robust (Quelle: Sustainable Development Goals Report 2022).

Wo steht Deutschland?
Deutschland gehört zu den führenden Ländern bei den öffentlichen Entwickungsausgaben und hat das für 2030 angestrebte Ziel, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens dafür auszugeben, bereits erreicht. Außerdem kommen immer mehr Menschen aus Entwicklungs- und Schwellenländern nach Deutschland, um hier zu studieren und zu forschen. Und auch die Einfuhren aus den am wenigsten entwickelten Ländern nach Deutschland wachsen stetig.
In Deutschland wird SDG 17 anhand dreier Indikatoren gemessen:
- Anteil öffentlicher Entwicklungsausgaben am Bruttonationaleinkommen: Ziel ist es, dass die 30 Geberländer, darunter Deutschland, und die Europäische Union bis 2030 jeweils 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens (BNE) als öffentliche Entwicklungsausgaben, auch „Official Development Assistance“ (ODA), genannt, an Länder des globalen Südens leisten. Die vorläufige ODA-Quote für 2021 liegt in Deutschland bei 0,74 Prozent, womit Deutschland das Ziel bereits erreicht hat (Quelle: BMZ).
- Anzahl von Studierenden und Forschenden aus Entwicklungsländern: Der internationale Wissensaustausch ist für eine nachhaltige Entwicklung zentral. Daher hatte es sich Deutschland zum Ziel gesetzt, den Anteil an Studierenden und Forschenden aus Entwicklungs- und Schwellenländern zwischen 2015 und 2020 um zehn Prozent zu steigern. Dies ist gelungen: 2019 studierten und forschten rund 285.000 Personen aus besagten Ländern in Deutschland, angestrebt waren 237.000. Die meisten Studierenden kamen aus China, der Türkei und Indien. Aus den am wenigsten entwickelten Ländern kommen jedoch nach wie vor nur sehr wenige Studierende und Forschende.
- Einfuhren aus den am wenigsten entwickelten Ländern: Die Öffnung der Märkte und bessere Handelschancen für die Länder des globalen Südens sind eines der Unterziele von SDG 17. Ziel Deutschlands ist es, den Anteil an Einfuhren aus den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2030 zu verdoppeln. Der Anteil dieser Einfuhren an den gesamten Einfuhren nach Deutschland lag 2019 bei 0,94 Prozent oder etwas mehr als zehn Milliarden Euro. Dies bedeutet eine Steigerung um 116 Prozent gegenüber 2002. Die meisten Einfuhren kamen aus Bangladesch und Kambodscha. Bei Fortschreibung des Trends wird das Ziel bis 2030 voraussichtlich erreicht (Quellen: Indikatorenbericht 2021, Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021).
Das zivilgesellschaftliche SGD-Monitoring „2030 Watch“ erweitert das Indikatorenset um drei qualitative Indikatoren, nämlich wie es um eine nachhaltige Entschuldungspolitik bestellt ist, inwiefern Handelsbarrieren abgebaut werden und ob die geleisteten ODA auch an den richtigen Stellen ankommen, um qualitativ eine nachhaltige Entwicklung in den betreffenden Ländern voranzubringen. Nimmt man diese Kriterien hinzu, schmälert sich der Fortschritt von über 100 Prozent auf rund 86 Prozent.
Welche Fortschritte gibt es auf europäischer Ebene?
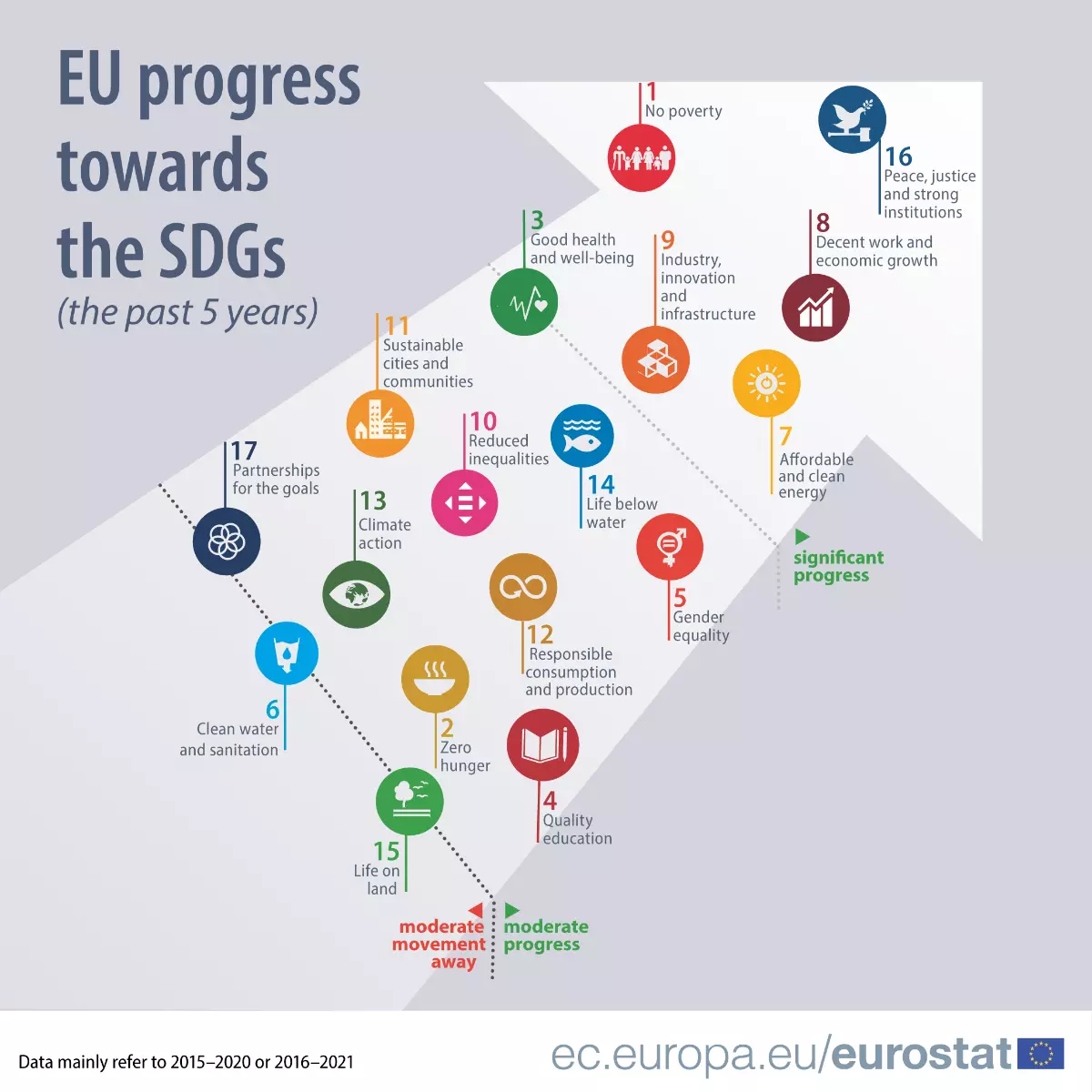
Auf europäischer Ebene gibt es seit 2017 ein EU-SDG-Indikatorenset mit rund 100 Indikatoren, um die Fortschritte der EU-Mitgliedstaaten zu messen. Eurostat veröffentlichte den letzten Monitoring-Bericht im Mai 2022. In dem dazu veröffentlichten Onlineartikel erklärt Eurostat, dass die EU in den fünf Jahren zwischen 2015/2016 und 2020/2021 bei fast allen SDGs Fortschritte erzielt habe. Eine Übersicht bietet die abgebildete Grafik.
Die größten Fortschritte seien bei der Förderung von Frieden und persönlicher Sicherheit im jeweiligen Hoheitsgebiet sowie bei der Verbesserung des Zugangs zur Justiz und beim Vertrauen in die Institutionen erzielt worden. Auch bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (SDG 1), der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt (SDG 8), sauberer und erschwinglicher Energie (SDG 7) sowie Innovation und Infrastruktur (SDG 9) seien erhebliche Fortschritte erreicht worden, wobei bei den vorliegenden Daten die Auswirkungen der Corona-Pandemie teilweise noch nicht berücksichtigt wurden. Geringe Verbesserungen seien in den Bereichen nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11), Verringerung der Ungleichheiten (SDG 10), verantwortungsvoller Konsum und verantwortungsvolle Produktion (SDG 12), hochwertige Bildung (SDG 4), Klimaschutz (SDG 13) und kein Hunger (SDG 2) gelungen. Bei den Partnerschaften zur Erreichung der Ziele (SDG 17) und bei der sauberen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (SDG 6) gäbe es dagegen keine positiven Trends und beim Erhalt und Schutz von Ökosystemen und Biodiversität seien sogar leichte Rückschritte zu verzeichnen. Dies zeige, dass die Ökosysteme und die biologische Vielfalt weiterhin durch menschliche Aktivitäten stark unter Druck stehen (Quelle: Eurostat).
Linksammlung
Quellen & weitere Infos
Allgemeine Links zu Nachhaltigkeit
Allgemeine Links zu Nachhaltigkeit
- BpB: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 21-22/2022): Ökologie und Demokratie
- BpB: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 31-32/2014): Nachhaltigkeit
- Bericht der Brundtland-Kommission: Our Common Future (1987)
- Vereinte Nationen: Agenda 21 (1992)
- BMZ: Agenda 2030 (2015)
- Nachhaltigkeitskonzept der EU-Kommission
- BMUV: EU-Nachhaltigkeitspolitik
- Bundesregierung: Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
- Bundesregierung: Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Weiterentwicklung 2021: Langfassung
- Bundesregierung: Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Weiterentwicklung 2021: Kurzfassung
- Rat für nachhaltige Entwicklung
- Sustainable Development Solutions Netzwork
- Nachhaltigkeitsstrategie in Baden-Württemberg
- Nachhaltigkeitsbüro der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
Links zu den SDGs
Links zu den SDGs
- BMZ: Agenda 2030 (2015)
- Bundesregierung: Nachhaltigkeitsziele verständlich erklärt
- UN: Ziele für nachhaltige Entwicklung – Bericht 2022
- UN: SDG Progress Chart 2022
- UN: SDG-Gipfel 2023
- UNRIC: 17 SDGs erklärt
- UNRIC: SDG-Brettspiel für Kinder
- EU-Monitoringbericht 2022 zu den Fortschritten bei der Verwirklichung der SDGs im EU-Kontext
- Eurostat: Übersicht über SDG-Indikatoren
- Statistisches Bundesamt: Indikatorenbericht 2021 zur nachhaltigen Entwicklung in Deutschland
- Statistisches Bundesamt: Datenblatt zum Indikatorenbericht 2021
- BMZ: Freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021
- Bundesregierung: Infoportal „Die glorreichen 17“
- Indikatorenbericht 2022 zur nachhaltigen Entwicklung in Baden-Württemberg
- Statusindikatoren einer nachhaltigen Entwicklung in Baden-Württemberg (2022)
- Dashboard aller statistischen Landesämter zum Bundesländervergleich bei den SDGs
- SDG-Portal zum Indikatorenvergleich zwischen den Kommunen
- Forum Umwelt und Entwicklung: Zivilgesellschaftliches Monitoring „2030 Watch“
- Global Policy Forum: Agenda 2030 – wo steht die Welt? 5 Jahre SDGs – eine Zwischenbilanz (2020)
- Engagement Global: Infoportal „17 Ziele“
Buch- und Linktipps zu „Nachhaltigkeit und Demokratie“
Buch- und Linktipps zu „Nachhaltigkeit und Demokratie“
- BpB: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 21-22/2022): Ökologie und Demokratie
- BpB: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 31-32/2014): Nachhaltigkeit
- Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung vom 29. April 2021 zum Klimabeschluss vom 21. März 2021
- Bürger & Staat 4-2022 „Nachhaltigkeit“
- Calliess, Christian: Möglichkeiten und Grenzen eines „Klimaschutz durch Grundrechte“ (Klimaklagen). Zugleich ein Beitrag zum Vorschlag von Ferdinand von Schirach für ein Grundrecht auf Umweltschutz, in: Berliner Online-Beiträge zum Europarecht Nr. 129 (April 2021)
- Friedrich-Ebert-Stiftung: Die geforderte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2020/21
- Gesang, Bernward (Hg.): Kann Demokratie Nachhaltigkeit?, 2014
- Heidenreich, Felix: Nachhaltigkeit und Demokratie. Eine politische Theorie, 2023
- humanrights.ch: Recht auf Umwelt – ein neues Menschenrecht
- IPG-Journal: Kann Demokratie Nachhaltigkeit?
- RIFS Potsdam: Bürgerräte
- RIFS Potsdam: Demokratie und Nachhaltigkeit
- Schaible, Jonas: Demokratie im Feuer, 2023
- Quent, Matthias u.a.: Klimarassismus. Der Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende, 2022.
- Varwick, Johannes: Auf dem Weg in die „Ökodiktatur“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 21-22/2022): Ökologie und Demokratie, S. 4-8
- Verfassungsblog: Debatte zum BVG-Klimabeschluss
Links zu BNE und WIA
Links zu BNE und WIA
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
- BMBF: BNE-Portal
- BMBF: Ratsempfehlung der Europäische Kommission zum Lernen für ökologische Nachhaltigkeit (2022)
- BMBF: Nationaler Aktionsplan BNE (2017)
- Kultusministerkonferenz (KMK): Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung (2015)
- Deutsche UNESCO-Kommission: Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Deutsche UNESCO-Kommission: UNESCO-Programm „BNE 2030“
- Kultusministerium und Umweltministerium Baden-Württemberg: „BNE-BW 2030 – Gemeinsamer Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2023)
- Kultusministerium: BNE in den Bildungsplänen von Baden-Württemberg
- Landesbildungsserver Baden-Württemberg zu BNE
- Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL): Handreichung BNE-Modellschulen
- BpB: Einführung in BNE
- Deutscher Volkshochschul-Verband: BNE
- Portal Globales Lernen: Lehr- und Lernmaterialien zu BNE
- Portal Globales Lernen: Die zwölf Kompetenzen der BNE nach Gerhard de Haan (2008)
- Landesschülerbeirat Baden-Württemberg: Ausschuss zu BNE
Whole Institution Approach (WIA)
- BMBF: BNE-Portal zum WIA
- Germanwatch: Lernorte für eine zukunftsfähige Gesellschaft
- Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerke in Deutschland (agl) zum WIA
- EPiZ: WIA an Seminaren in Baden-Württemberg
- Greenpeace – Schools for Earth: Whole School Approach – Ganzheitlicher Ansatz zur Schulentwicklung (2021)
- World Future Council: Advancing Education For Sustainable Development (Whole School Approach) (2019)
Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: Mai 2023.





